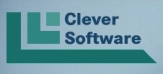Unmenschliche Gender-Maßstäbe
Montag 21. Februar 2011 von Institut für Demographie, Allgemeinwohl und Familie e. V.
Unmenschliche Gender-Maßstäbe
„Man hat nicht ein Geschlecht, sondern man verhält sich entsprechend.“ Dies ist die Quintessenz des neuen Menschenbildes, das seit der Jahrtausendwende amtliche Berichte der Bundesregierung propagieren. Zwar räumen Regierungsexperten ein, dass man selbstverständlich zwischen Männern und Frauen unterscheide. Das sei jedoch das Produkt „sozialisatorischer Überformungen“, eines so genannten „doing gender“. Geschlecht gilt in diesem Weltbild nicht als eine natürlich-biologische Kategorie („sex“), sondern als „eine soziale und kulturelle Konstruktion“ („gender“) (1). Diesen Bauplan umzuschreiben, das ist Ziel des „Gender Mainstreaming“. Es verpflichtet die politischen Akteure, „ihre Entscheidungen so zu gestalten, dass sie zur Förderung einer tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter beitragen“ (2). Jedwede Unterschiede in den Lebensverhältnissen der Geschlechter betrachten seine Advokaten – jedenfalls solange sie Männer begünstigen – als Folge einer Frauen diskriminierenden „Geschlechterhierarchie“. Deren Machtverhältnisse manifestierten sich insbesondere im Maßstab des Geldes: Lohndifferenzen zuungunsten von Frauen gelten daher per se als Ausdruck mangelnder Chancengerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Diese Lohndifferenzen misst der „Gender Pay Gap“: Als solcher firmiert im amtlichen Sprachgebrauch die Differenz des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes zwischen Männern und Frauen. Nach diesem Maß verdienen Frauen in Deutschland etwa ein Fünftel weniger als Männer (3). Diese Differenz einzuebnen ist zentrales Anliegen der Beschäftigungspolitik; in der amtlichen Statistik firmiert ein (möglichst verschwindender) „Gender pay gap“ als Indikator für „sozialen Zusammenhalt“ und „Nachhaltigkeit“ (4).
Der „Gender Pay Gap“ kann verschiedene Ursachen haben: Ungleichheit der betrieblichen Positionen und Aufstiegschancen ebenso wie Unterschiede in der Qualifikation und Art des Berufs. Diese Faktoren lässt der aufgrund von EU-Beschlüssen europaweit verwendete Indikator „Gender Pay Gap“ jedoch völlig unberücksichtigt. Er ist ein abstraktes Gleichheitsmaß, das die Vielfalt der Arbeits- und Lebensverhältnisse ausblendet. Ein differenzierteres Bild der geschlechtsspezifischen Entlohnung gibt der sog. „bereinigte“ Gender Pay Gap: Er erfasst Lohnunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Arbeitnehmern mit vergleichbaren Eigenschaften in Bezug auf Qualifikation, berufliche Branche und Position etc. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes beträgt dieser Verdienstunterschied rund 8 Prozent (5). Dies bedeutet einerseits: Auch bei gleicher Tätigkeit und Qualifikation, in derselben Branche und vergleichbarem Beschäftigungsumfang werden Frauen immer noch schlechter bezahlt als Männer. Andererseits folgt daraus: Mehr als zwei Drittel der Verdienstdifferenz sind darauf zurückzuführen, dass Frauen häufiger geringfügig und in Teilzeit beschäftigt sind, Stellen mit geringerem Qualifikationsprofil besetzen und vor allem geringer entlohnte Tätigkeiten ausüben (6).
Eine Schlüsselrolle für das Gender Pay Gap spielt die Berufswahl: Häufiger als Männer sind Frauen in Berufsfeldern tätig, in denen schlecht bezahlt wird. Exemplarisch dafür sind Altenund Krankenpflegerinnen. Ihre Tätigkeit erfordert neben fachlichen und sozialen Qualifikationen zusätzlich noch eine hohe körperliche und seelische Belastbarkeit. Die Arbeitsbedingungen sind als hart bekannt; dennoch sind diese Berufe wenig angesehen und vergleichsweise schlecht entlohnt. Besonders unattraktiv sind die Arbeitszeiten: Es handelt sich um 24-Stunden Berufe mit Nachtschichten und Überstunden als Regelfall. Verantwortlich dafür sind letztlich die Lebensbedürfnisse von alten und kranken Menschen: Sie richten sich eben nicht nach festen Büro- und Maschinenlaufzeiten und dem Wunsch nach „Feierabend“. Fürsorge für alte und kranke Menschen (wie auch die für Kinder) sperrt sich gegen eine ökonomisch-rationale Zeitstruktur, die nach dem Prinzip „Zeit ist Geld“ funktioniert: Es geht nicht primär darum (Arbeits-)Zeit zu „sparen“, sondern Lebenszeit auszufüllen, schließlich sind nicht Maschinen zu bedienen, sondern Menschen zu pflegen (7).
Die dafür erforderliche persönliche Zuwendung und Empathie werden durch den von chronischer Finanznot diktierten Effizienzdruck im Sozialsystem erschwert oder gar unmöglich gemacht. Dieser Rationalisierungszwang verunsichert die vom Wunsch Menschen zu helfen motivierten Pflegerinnen in ihrem Berufsethos (8). Trotz dieses Zeitdrucks, trotz schwieriger Arbeitsbedingungen und allenfalls mäßiger Bezahlung, entscheiden sich noch immer viele junge Frauen für Pflege- und Gesundheitsberufe. Aus der Sicht der Gender-Theorie bleiben sie damit Geschlechtsrollen verhaftet, die Fürsorglichkeit als „weibliches Wesensmerkmal naturalisieren“. Auch gegen solche „Stereotypen“ der Mitmenschlichkeit kann sich die Politik des Gender Mainstreaming richten (9). Ihre Erfolgsmaßstäbe lauten Geld („Gender Pay Gap“) und beruflicher Status – Stichwort „Quote“. Die der Humanität dienende Fürsorgeleistung von Frauen, von Pflegerinnen im Dienst wie von Müttern in der Familie, droht als vermeintliche quantité negligeable vergessen zu werden (10).
(1) „Seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ist zunehmend zu konstatieren, dass „im Zuge des Paradigmenwechsels in der Frauen- und Geschlechterforschung die Kategorie Geschlecht selbstkritisch betrachtet und die Differenz zwischen den Geschlechtern als naturalisierte Klassifikation einer Zweigeschlechtlichkeit infrage gestellt wurde“ […]. Geschlecht wird zunehmend als eine soziale und kulturelle Konstruktion verstanden, als „doing gender“. Man „hat“ nicht ein Geschlecht, sondern man verhält sich entsprechend. Damit richtet sich der Blick nicht so sehr auf biologische Differenzen, sondern zuallererst auf die Konstitution von „Zweigeschlechtlichkeit“. Siehe: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland (Elfter Kinder- und Jugendbericht), Berlin 2002, S. 108.
(2) Siehe: http://www.gender-mainstreaming.net.
(3) Statistisches Bundesamt: Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Indikatorenbericht 2010, Wiesbaden 2010, S. 56-57.
(4) Siehe ebenda.
(5) Vgl.: Claudia Finke: Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen, S. 36-S. 48, in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Wirtschaft und Statistik Januar 2011, S. 47.
(6) Vgl. ebd., S. 45.
(7) „Die berufliche Pflegetätigkeit wie auch die fürsorgliche Praxis in der eigenen Familie haben gemeinsam, dass es sich um eine Aufgabe von tendenziell 24 Stunden am Tag handelt. Die Zeit, in der ein Mensch gepflegt wird, ist seine Lebenszeit; dabei geht es nicht um gesparte, sondern um erfüllte Zeit, nicht um instrumentelle, sondern um Fürsorgerationalität. […] Was braucht er oder sie? Diese Tätigkeiten stehen unter dem Gesichtspunkt einer Fürsorgerationalität. Sie steht durchaus sperrig gegen eine an instrumenteller Rationalität orientierte Zeitstruktur, die nach dem Prinzip „Zeit ist Geld“ funktioniert und in den Einrichtungen in jüngerer Zeit immer stärker dominiert.“ Siehe: Eva Senghaas- Knobloch: Care- Arbeit und das Ethos fürsorglicher Praxis unter neuen Marktbedingungen am Beispiel der Pflegepraxis, S. 231-243, in: Berliner Journal für Soziologie, Band 18 – 2008, S. 232 und S. 239. Siehe hierzu auch: http://www.i-daf.org/146-0-Woche-15-2009.html.
(8) Hierzu Senghaas-Knobloch: „Die Zettel sterben nicht, die Patienten schon“: Mit diesem provokativen Satz wird der Versuch gemacht, auf den drohenden Verfall des Ethos fürsorglicher Praxis hinzuweisen, demzufolge Pflegekräfte unter bestimmten Umständen die immer stärker komprimierte Zeit auf die von ihnen verlangte Dokumentation von Handlungen konzentrieren und dabei unter Umständen die dokumentierten Handlungen selbst versäumen.“ Ebenda, S. 236.
(9) So fordert die EU-Kommission, um der Geschlechtergleichheit entgegenstehende „kulturelle Barrieren“ abzubauen, ein „Vorgehen gegen stereotype Vorstellungen von Frauen und Männern“. Siehe: Bericht der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur Gleichstellung von Frauen und Männern – 2008, Bundesratsdrucksache 158/08, Köln 2008, S. 8-9 sowie S. 6.
(10) Diese Gefahr sehen durchaus auch „feministisch“ orientierte Autorinnen: „Das herausragende Gewicht, das der Erwerbsarbeit als einziger, wertvollster oder wichtigster sozialer Aktivität zugemessen wird, birgt das Risiko, dass die Notwendigkeit und der Wert von Betreuungsarbeit, ob bezahlt oder unbezahlt, verdeckt bleibt. Care als sinnvolle und beziehungsfördernde, identitätsstiftende Aktivität droht sowohl aus den Debatten über die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen wie auch aus den Diskussionen über Investitionen in die frühkindliche Entwicklung herauszufallen.“ Siehe: Chiara Saraceno: „Care“ leisten und „Care“ erhalten zwischen Individualisierung und Refamilialisierung, S. 244-256, in: Berliner Journal für Soziologie, Band 18/2008, S. 251.
IDAF Nachricht der Wochen 7-8 / 2011
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 21. Februar 2011 um 11:26 und abgelegt unter Ehe u. Familie, Gesellschaft / Politik, Sexualethik.