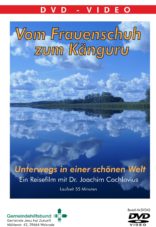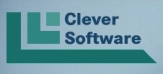So hat es Luther nicht gemeint
Donnerstag 16. Dezember 2010 von Pfr. Dr. Jochen Teuffel

So hat es Luther nicht gemeint
Der evangelische Gottesdienst ist heute nicht mehr auf Christus ausgerichtet, sondern auf eine triviale Idee von Freiheit. Das Reformationsjubiläum kann abgesagt werden.
Sechs Jahre noch, dann wird das f√ľnfhundertste Jubil√§um der Reformation in Deutschland ganz gro√ü gefei¬≠ert werden. Zur Einstimmung darauf wur¬≠de bereits 2008 eine Lutherdekade mit wechselnden Jahresthemen ausgerufen. Das kennt man aus dem Vereinsleben: Wo in Sachen eigener Vergangenheit be¬≠sonders ausgiebig jubiliert wird, ist man in der Gegenwart mit den eigenen Aktivi¬≠t√§ten dank √úberalterung und Mitgliederschwund ziemlich am Ende.
Der Abgesang auf die Volkskirche wird als Basso continuo die Lutherdekade be¬≠gleiten, bevor dann am 31. Oktober 2017 in Wittenberg eine Farce zur Auff√ľhrung kommt: In einer Stadt, in der Kirche im Verschwinden begriffen ist ‚ÄĒ kaum mehr als ein Prozent der dortigen Bev√∂lkerung nimmt noch sonntags am Gottesdienst teil ‚ÄĒ, soll in aller √Ėffentlichkeit einer iden¬≠tit√§tsstiftenden Kirchenreform gedacht werden. Dass dieses Schauspiel inszeniert werden kann, verdankt sich dem Jahresthema der Lutherdekade f√ľr 2011 ‚ÄĒ ‚ÄěRefor¬≠mation und Freiheit‚Äú. Was der b√ľrgerliche Protestantismus in Sachen Reformation zu gedenken wei√ü, ist die Emanzipation aus kirchlicher Bevormundung, so wie dies ja schon der Philosoph Hegel zur Spra¬≠che gebracht hat: ‚ÄěDies ist der wesentliche Inhalt der Reformation; der Mensch ist durch sich selbst bestimmt, frei zu sein.‚Äú
Freiheit um Christi Willen
Wird Reformation als Freiheitsereignis verstanden, f√ľhlt sich das sp√§tmoderne B√ľrgertum trotz aller Kirchendistanz an¬≠gesprochen. In der Tat hat die Reformati¬≠on in Deutschland das mittelalterliche Corpus Christianum konfessionell aufge¬≠sprengt. Diese sakrale Einheit von Kir¬≠che und Gesellschaft verdankte sich ei¬≠ner fragw√ľrdigen kollektiven Christiani¬≠sierungs¬≠praxis. Im fr√ľhen Mittelalter wur¬≠den Menschen in Gefolgschaft ihrer Stammesf√ľrsten in passiver Weise ‚Äěbe¬≠kehrt‚Äú. √úber mehr als ein Jahrtausend hinweg gab es in Europa keine gesell¬≠schaftliche Existenz au√üerhalb der Kir¬≠che. Durch Glaubenszwang, Pflichtbeich¬≠te, Sonntagspflicht sowie Kirchenzucht wurde eine √∂ffentliche Regelkonformit√§t in Sachen Christentum erzwungen.
Es war die reformatorische Botschaft von der Rechtfertigung allein aus Glau¬≠ben, die menschlichen Ordnungen in der Kirche ihre vermeintliche Heilsnotwen¬≠digkeit genommen hat. Damit wurde langfristig die gesellschaftliche Ausbil¬≠dung moderner Freiheitsrechte bef√∂r¬≠dert. Und dennoch steht die ‚ÄěFreiheit ei¬≠nes Christenmenschen‚Äú, wie sie von Mar¬≠tin Luther propagiert wurde, weder f√ľr b√ľrgerliche Freiheit noch f√ľr religi√∂se Freisinnigkeit. Luther zufolge ist dem durch und durch s√ľndigen Menschen die wirkliche Freiheit nicht angeboren. Er hat auch kein eigenes Recht darauf, vor dem dreieinigen Gott frei zu sein. Wer aus eigenen St√ľcken sich selbst f√ľr frei erkl√§rt, wird in Wirklichkeit vom Teufel ge¬≠ritten. Die wahre Freiheit ist eine im Evangelium zugesagte Freiheit ‚Äěum Christi Willen‚Äú, der immer wieder aufs Neue zu glauben ist. Nur dort, wo Men¬≠schen in Wort und Sakrament an das Pa¬≠scha-Mysterium Christi gebunden sind, ereignet sich evangelische Freiheit, die von menschlichen Satzungen und Gebo¬≠ten unabh√§ngig macht. So spricht es ja auch der Apostel Paulus aus: ‚ÄěSei es Welt, Leben oder Tod, sei es Gegenw√§rti¬≠ges oder Zuk√ľnftiges: Alles ist euer, ihr aber geh√∂rt Christus.‚Äú
Wo jedoch das kollektive Ged√§chtnis einer b√ľrgerlichen Gesellschaft von der mittelalterlichen Zwangskollektivierung in einer hierarchischen Kirche voreinge¬≠nommen ist, kann die evangelische Dia¬≠lektik der Freiheit keine Geltung entfal¬≠ten. Stattdessen sucht sich der b√ľrgerli¬≠che Protestantismus guten Gewissens von der kirchlichen Gemeinschaft zu sus¬≠pendieren und beruft sich dazu auf Lu¬≠ther als vermeintlichen Ahnherrn religi√∂¬≠ser Selbstbestimmung. Dabei wird an Stelle des zugesprochenen Glaubens ein subjektives Glaubensbewusstsein apo¬≠strophiert, das keine fremde Autorit√§t anerkennt: Was ich f√ľr mich selbst zu glauben wei√ü, muss ich mir von nieman¬≠dem gesagt sein lassen. Die christusbe¬≠stimmte Lehre von der Rechtfertigung al¬≠lein aus Glauben wird zur kultfreien Lebenszuver¬≠sicht trivialisiert, die sich an ei¬≠ner vermeintlich freiheitsstiftenden Got¬≠tesidee denkerisch festmacht.
Wird Rechtfertigung des S√ľnders al¬≠lein aus Glauben als menschenm√∂gliche Idee missverstanden und damit nicht l√§n¬≠ger als g√∂ttliches Geschehen zugesagt, kann man sich guten Gewissens von der kirchlichen Gemeinschaft emanzipie¬≠ren. Was selbst gedacht werden kann, muss eben nicht gemeinschaftlich ge¬≠h√∂rt oder getan werden. Auf Liturgie l√§sst sich also selbstgewiss verzichten.
Protestanten sind so frei, sich guten Gewissens einer ‚ÄĒ im wahrsten Sinne des Wortes ‚ÄĒ asozialen Religiosit√§t zu verschreiben. Wer sich als religi√∂ser Au¬≠tist den Kirchgang erspart, scheint die protestantische Freiheit in besonderer Weise zu realisieren. Kein Wunder, dass Sonntagsgottesdienste im Durchschnitt von weniger als vier Prozent der Kirchen¬≠mitglieder besucht und ‚ÄĒ entgegen refor¬≠matorischer Intention ‚ÄĒ √ľberwiegend ohne Abendmahl gefeiert werden. Und wenn Kindertaufen anstehen, werden diese als liebevolle Familienevents insze¬≠niert. Ist religi√∂se Eigensinnigkeit erst einmal zum kirchlichen Ma√üstab erhoben, kann man nicht anders denn auf √Ąsthetik (f√ľr das Bildungsb√ľrgertum) und Gef√§lligkeit (f√ľr das Volk) setzen.
Allenfalls dann, wenn in Lebenskri¬≠sen die eigenreligi√∂se Kontingenzbew√§l¬≠tigung versagt, darf es in der Kirche ‚Äď oder zumindest am Grab ‚Äď pastoral-tr√∂st¬≠lich zugehen. Wenn es jedoch ums Geld geht, h√∂rt die protestantische Freiheit auf. Trotz aller religi√∂sen Unverbindlich¬≠keit muss auch der Protestant seiner ‚ÄěKir¬≠che der Freiheit‚Äú (Wolfgang Huber) fi¬≠nanziellen Tribut zollen. An Stelle frei¬≠williger Gaben wird in Form der Kirchen¬≠steuer eine √∂ffentlich-rechtliche Zwangsabgabe erhoben, der man sich nur durch Kirchenaustritt vor dem Standesamt ent¬≠ziehen kann.
Der b√ľrgerliche Protestantismus steht f√ľr eine neuplatonisch gepr√§gte Weltanschauung mit Dienstleistungsservice f√ľr besondere Anl√§sse und hat mit der Kir¬≠che der Reformation wenig gemein. Schlie√ülich ging es den Reformatoren im sechzehnten Jahrhundert prim√§r um eine evangeliumsgem√§√üe Reform der Kir¬≠che an Haupt und Gliedern und nicht etwa um eine freisinnige Emanzipation von der Kirche. So erkl√§rt denn auch Lu¬≠ther im Gro√üen Katechismus, dass der Heilige Geist ‚Äěuns zuerst in seine heilige Gemeinde f√ľhrt und in den Scho√ü der Kirche legt, durch welche er uns predigt und zu Christus bringt‚Äú. Die Kirche gilt als ‚ÄěMutter, welche einen jeden Christen zeugt und tr√§gt durch das Wort Gottes‚Äú.
Freisinnigkeit als Dogma
Nach Luther ist also Christsein nur in der Lebensgemeinschaft Kirche m√∂glich. Folgerichtig ist in den Verfassungen der evangelischen Landeskirchen die ge¬≠meinschaftliche Regelbindung auf Chris¬≠tus explizit ausgesprochen. Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer sind bei ihrer Ordination √∂ffentlich verpflichtet wor¬≠den, ‚Äědas anvertraute Amt in Gehorsam gegen Gott in Treue zu f√ľhren, sowie das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Be¬≠kenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, rein zu lehren‚Äú. Doch in der Praxis wird genau diese gemein¬≠schaftliche Regelbindung der Ideologie religi√∂ser Freisinnigkeit geopfert. Da k√∂nnen dann Pfarrer in kirchlichen Publi¬≠kationen oder von der Kanzel herab mit aller Selbstgewissheit behaupten, der Kreuzestod Jesu enthalte keine Heilsbot¬≠schaft, ohne dass derartige Regelverst√∂¬≠√üe kirchlich beanstandet werden.
Solange man Kirche als weltanschauli¬≠ches Unternehmen missversteht, das auf einer Gottesidee sowie je eigenen religi√∂sen Vorstellungen basiert, kann der Re¬≠formation nicht wirklich gedacht wer¬≠den. W√§re man in der Evangelischen Kir¬≠che in Deutschland (EKD) ehrlich zu sich selbst, m√ľsste das Reformationsjubi¬≠l√§um kirchenintern abgeblasen werden. Nur so bliebe eine peinliche Selbstinsze¬≠nierung religi√∂ser Freisinnigkeit in kleri¬≠kalem Gewande erspart.
Das w√ľrde jedoch mitnichten ein Aus f√ľr das Reformationsjubil√§um 2017 be¬≠deuten. Schlie√ülich gibt es ja landeskirch¬≠liche Gemeinden, Freikirchen und pietis¬≠tische Gemeinschaften, die dem Erbe der Reformation sehr wohl treu geblie¬≠ben sind. Und selbst die r√∂misch-katholi¬≠sche Kirche kann dem Anliegen der Re¬≠formation einiges abgewinnen; schlie√ü- lich hat sich deren liturgische Erneue¬≠rung im letzten Jahrhundert auf die Christusgemeinschaft hin ausgerichtet. Da mag es Sonderlehren geben, die evan¬≠gelische Christen mit gutem Grund f√ľr sich nicht anzunehmen wissen, dennoch steht die r√∂misch-katholische Kirche in ihrer lehramtlichen Christuszentrierung der Reformation n√§her als ein freisinni¬≠ger Protestantismus.
Ecclesia semper reformanda ‚Äď Kirche ist immer zu reformieren, um dem Evan¬≠gelium treu zu bleiben. Was ansteht, ist eine umfassende Kirchenreform hin zur Gemeinschaftskirche ohne Kirchensteu¬≠ern. Andernfalls wird die vermeintliche Volkskirche in einem zivilreligi√∂sen Paganismus aufgehen. Dann wird man auch in Kirchen einen Heidenspa√ü ha¬≠ben ‚Äď aber der l√§sst das eigene Leben am Ende ins Leere laufen.
Jochen Teuffel ist evangelischer Gemeindepfarrer in V√∂hringen/Iller. Im vergangenen Jahr ver√∂ffent¬≠lichte er das Buch ‚ÄěMission als Namenszeugnis ‚Äď Eine Ideologiekritik in Sachen Religion‚Äú.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittwoch, 15. Dezember 2010, Nr. 292, Seite 33.
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Donnerstag 16. Dezember 2010 um 16:22 und abgelegt unter Kirche, Theologie.