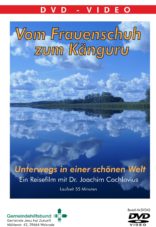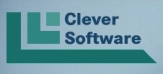„Ich bin Missionar.“
Montag 10. Januar 2011 von Pfr. Dr. Jochen Teuffel

Ich bin Missionar. Richtet die Verbreitung der christlichen Botschaft Unheil an?
Zugegeben, ich bin Missionar. Missionar sein war einmal eine respektable Berufung im 19. Jahrhundert. Die nach Ăbersee entsandten Missionare erfuhren allgemeines Wohlwollen in der deutschen Bevölkerung. Wer heute hingegen als christlicher Missionar tĂ€tig ist, sieht sich kritischen Anfragen ausgesetzt. Andere Völker fĂŒr den christlichen Glauben zu gewinnen wird oft als kulturzerstörisch angesehen. Das deutsche Spenderherz lĂ€sst sich fĂŒr Katastrophenhilfe bewegen; in Sachen Seelenheil scheint jedoch niemandem zu helfen zu sein.
Als Missionar in Hongkong ist man heutzutage nicht an vorderster Front. Das persönliche Bekehrungszeugnis von jungen Chinesen im Freundeskreis ist viel gewinnender als ErklĂ€rungsversuche unsereins, denen das Christsein in die Wiege gelegt wurde. So besteht meine TĂ€tigkeit an einer Kirchlichen Hochschule vor allem darin, Theologiestudierende aus SĂŒdostasien in der Grammatik der christlichen Lehre zu unterrichten. Als Missionar missioniert man nicht mehr; man dient einer einheimischen Partnerkirche in deren BemĂŒhungen um den christlichen Glauben.
Konfrontiert man Christen in Hongkong mit deutscher Missionskritik, stöĂt man auf UnverstĂ€ndnis: Warum nicht die Botschaft propagieren, die man selbst als heilvoll erfahren hat? So verwundert es nicht, dass unter Christen in Hongkong ein starker missionarischer Impetus vorhanden ist: Gemeindeglieder nehmen in ihrer Urlaubszeit an Missionstrips nach China teil; verschiedene Kirchen entsenden Missionare in andere LĂ€nder. Damit folgen sie einem allgemeinen Trend. WĂ€hrend die Mission vormals das Werk von EuropĂ€ern und Nordamerikanern war, haben sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts die missionarischen AktivitĂ€ten hin zu den Kirchen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas verlagert.
Was sich kirchenentwöhnte Deutsche kaum vorstellen können, ist, dass das Christentum auf anderen Kontinenten „heiĂ“ ist. Es wird dort als etwas angenommen, womit man das eigene Leben nicht nur bewĂ€ltigen, sondern verbessern kann. Die Grundlage ist eine Wirklichkeitsdimension, die fĂŒr auĂereuropĂ€ische Kulturen grundlegend ist: AuĂerhalb einer sichtbaren Welt, die wissenschaftlich beschrieben werden kann, existiert eine SphĂ€re von unsichtbaren, einflussreichen MĂ€chten. Sie wirken sich in einem organischen Zusammenhang auf das Leben entweder positiv oder negativ aus. Man muss sich daher durch richtiges Tun und Verhalten in eine wohlgefĂ€llige Beziehung zu ihnen bringen.
Es ist dieser organische Lebenszusammenhang, der den NĂ€hrboden fĂŒr Bekehrungen bildet. Die christliche Lehre erweist sich als effektive religiöse Wohlergehenslehre, als DiĂ€tetik: Sie wird als Erlösung von einem selbstempfundenen SchuldverhĂ€ngnis erfahren, als Zugang zu der Ăber-Macht des einen Gottes, zu Schutz, Heilung, Wohlstand. SchlieĂlich empfinden Christen eine bisweilen ekstatische ErmĂ€chtigung durch den Heiligen Geist und göttliche „callings“ als Impuls zu einer selbstgewissen LebensfĂŒhrung.
Leben, Ăbersetzung, Bildung
All dies bewirkt mehr als Sinnstiftung oder KontingenzbewĂ€ltigung. Der Glaube erscheint als Lebensressource, nicht als aufoktroyierte Vorschrift. Menschen nehmen Christus an, weil das ihrer Lebensweise zusagt. Die biblische Lebensform ist der Lebenssituation in Afrika oder Asien weit nĂ€her als im postindustriellen Europa. So genĂŒgt eine sprachliche Ăbersetzung ohne hermeneutische Allegoresen. Wenn dann noch Lebenszeugnisse von Bekannten das Heil bewahrheiten, liegt die eigene Bekehrung von selbst nahe. Umgekehrt bestĂ€tigt die Bekehrung eines Mitmenschen das eigene Christsein. So sind die Christen selbst daran interessiert, ihre Erfahrungen in gewinnender Weise „NichtglĂ€ubigen“ gegenĂŒber zu bezeugen.
AuffĂ€lligerweise war die christliche Mission in SĂŒdostasien gerade unter MinoritĂ€ten erfolgreich, wie zum Beispiel den Chins in Birma oder den Montagnards in Vietnam. Teilweise wurde Mission gegen den Willen einer europĂ€ischen Kolonialverwaltung betrieben, wie im Falle der Nagas in Nordostindien, wo gegenwĂ€rtig mehr als 90 Prozent der Bevölkerung Baptisten sind. Als Ex-Monty Python Michael Palin in seiner BBC-Fernsehserie ĂŒber den Himalaja seinen einheimischen Ăbersetzer fragte, warum die Konyaks, ein Naga-Stamm von ehemaligen KopfjĂ€gern, die christliche Lehre angenommen haben, erhielt er die knappe Antwort: wegen der Bildung.
In der Tat ist die christliche Lehre ein wesentlicher BildungstrĂ€ger, basiert doch in vielen LĂ€ndern das Schulsystem auf vormaligen Missionsschulen. Im Unterschied zum Koran ist die Bibel von Anfang an in einheimische Sprachen ĂŒbersetzt worden. Vor allem die protestantische Mission hat auf die Wirkung der gedruckten Bibel gesetzt und dazu die meisten Schriftsprachen durch Ăbersetzungen geschaffen. Gott spricht die eigene Muttersprache. Um sein Wort fĂŒr das eigene Leben zu erfahren, muss man die Bibel lesen können. FĂŒr Stammeskulturen entsteht ein Anreiz zum Erlernen der eigens geschaffenen Schriftsprache. Diese wird wiederum dazu verwendet, die eigene Kultur zu verschriftlichen. Der Einfluss von BibelĂŒbersetzungen fĂŒr die Bewahrung des tribalen kulturellen Erbes kann daher nicht hoch genug eingeschĂ€tzt werden.
Neuheidnischer Paternalismus
Tribale Gesellschaften stehen durch Kolonialisierung, nationalstaatlichen Territorialismus sowie ökonomische Globalisierung unter Assimilierungsdruck. Wo eine ĂŒberkommene Götter- oder Geisterwelt als Schutzmacht solchem VerĂ€nderungsdruck nicht gewachsen ist, entsteht ein Machtvakuum, das zu einem kulturzerstörerischen Fatalismus fĂŒhren kann. Der muttersprachlich assimilierte christliche Glaube hingegen versichert sich des Beistandes des einen ĂŒbermĂ€chtigen Gottes. Mit derartigem RĂŒckhalt können ModernisierungseinflĂŒsse von auĂen unter Beibehaltung der eigenen kulturellen IdentitĂ€t aufgenommen werden.
Entgegen dem gĂ€ngigen Vorurteil ist die christliche Mission durch ihre Ăbersetzungsleistung nicht kulturzerstörerisch. Es ist gerade die indigenisierte christliche Lehre, die die IdentitĂ€t von tribalen MinoritĂ€ten gegen Assimilierungsversuche seitens dominanter „Staatsvölker“ wie beispielsweise die Birmanen in Burma bewahrt. Ohne Eigenstaatlichkeit sind Stammesgesellschaften von der internationalen Völkergemeinschaft ausgeschlossen – nicht jedoch von der christlichen Ăkumene. Das weltweite Netzwerk der Partnerkirchen verschafft ihnen Protektion und Bildungsressourcen, die ihnen im eigenen Land verwehrt sind.
Wenn EuropĂ€er die Mission ablehnen, ignorieren sie die eigene tribale Vergangenheit. Die europĂ€ische Zivilisation verdankt sich dem Umstand, dass die christliche Mission unter germanischen Stammesgesellschaften vor mehr als tausend Jahren erfolgreich gewesen ist. Ohne die Kirche sind Schriftlichkeit und die Aneignung des klassischen Bildungsguts kaum vorstellbar. Warum sollte man dies anderen Kulturen nicht zugestehen? Wenn heute Mission das Werk einheimischer Christen ist, lĂ€sst sich der Paternalismusverdacht umkehren: EuropĂ€er, die die Mission verteufeln, projizieren ihre neuheidnischen Vorbehalte in andere Kulturen: „Was fĂŒr uns nicht (mehr) von Bedeutung ist, kann fĂŒr euch auch nicht gut sein.“ Nicht die Mission, sondern deren Ablehnung ist ein eurozentristischer Versuch, andere Völker zu paternalisieren. Der Anspruch, eine „authentische“ Kultur schĂŒtzen zu wollen, spiegelt einen GEO-Naturalismus wieder, der Menschen mit ihren eigenen Aspirationen nicht erst genug nimmt. Die propagierte KulturauthentizitĂ€t reduziert sie zu exotischen „Naturvölkern“, die als ethnologische Studienobjekte oder Tourismusattraktionen wahrgenommen werden. Diese Haltung kann leicht eine rassistische Schieflage annehmen, wenn es darum geht, „Naturvölker“ zusammen mit Wildtieren in ihrer vermeintlichen UrsprĂŒnglichkeit zu schĂŒtzen.
Christliche Mission hingegen enthĂ€lt eine Absage an jede Form von Rassismus, werden doch Menschen unabhĂ€ngig von Rasse oder Geschlecht auf einen gleichen Status hin angesprochen, entweder als todbestimmte SĂŒnder, die nicht rettungslos verloren sind, oder als Schwestern und BrĂŒder im Herrn. Missionare agieren nicht aus einem ĂberlegenheitsgefĂŒhl heraus, sondern teilen das mit anderen, was sie selbst als heilvoll erfahren haben. Wo andere Menschen die christliche Botschaft fĂŒr sich annehmen, entsteht eine Gemeinschaft mit Verpflichtungen, die nicht immer spannungsfrei ist. Exotische „Naturvölker“ kann man sich auf Distanz halten, nicht aber Menschen, von denen Jesus im Gleichnis vom Weltgericht sagt: „Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten BrĂŒder getan habt, habt ihr mir getan.“
Jochen Teuffel ist evangelischer Gemeindepfarrer in Vöhringen/Iller. Im vergangenen Jahr veröffentÂlichte er das Buch âMission als Namenszeugnis â Eine Ideologiekritik in Sachen Religionâ.
Quelle: SĂŒddeutsche Zeitung, Nr. 239, Mittwoch, 17. Oktober 2007, Seite 15.
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 10. Januar 2011 um 16:21 und abgelegt unter Christentum weltweit.