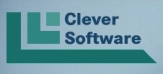Glauben Christen und Muslime an den gleichen Gott?
Dienstag 10. Januar 2017 von Prof. Dr. Rolf Hille

Deutschland ist durch den Terroranschlag in Berlin aufgew√ľhlt. Sind wir dem Islamismus und seiner Gewaltbereitschaft ausgeliefert? Was kann unsere freiheitliche Gesellschaft gegen die Bedrohung tun? Die Fragen, die hier zu stellen sind, lassen sich nicht von den religi√∂sen Hintergr√ľnden abl√∂sen. F√ľr Christen gilt es, sowohl f√ľr ein friedliches Zusammenleben einzutreten, als auch eindeutig am christlichen Glaubensbekenntnis und der Geltung des Missionsbefehls festzuhalten.
Nun hat der Bischof der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck, Dr. Martin Hein, aus Kassel sich in den letzten Wochen mehrfach zu dieser Thematik ge√§u√üert. Im November sprach er sich vor seiner Landessynode unter dem Stichwort ‚ÄěDer barmherzige Gott‚Äú daf√ľr aus, dass die drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam zum gleichen Gott beten. In einem darauffolgenden Interview mit der Tageszeitung ‚ÄěHessische Allgemeine‚Äú fasste er seine Gedanken unter diesem Motto nochmals zusammen. Inhaltlich etwas entfaltet und differenzierter pl√§dierte der Kirchenf√ľhrer schlie√ülich f√ľr interreligi√∂se Gemeinsamkeit am 5. Dezember 2016 beim gemeinsamen Jahresempfang der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Kommissariats der deutschen Bisch√∂fe.
1. Das ist unbestritten: wir schulden jedem Menschen Respekt
Das Ziel, das Bischof Hein mit seinen diversen √Ąu√üerungen vor Augen steht, ist eindeutig. Er verkn√ľpft die Forderung politischer Toleranz mit der theologischen Frage nach den Grundlagen f√ľr die religi√∂se Gemeinschaft zwischen Judentum, Christentum und Islam. Seine Begr√ľndung hierf√ľr ist, dass es sich bei allen drei Religionen um einen gemeinsamen monotheistischen Gottesglauben handelt, der von allen Religionsangeh√∂rigen gleicherma√üen gesucht und angebetet wird. Kontrovers sei in diesem Kontext nur der Weg, auf dem das Gebet praktiziert wird. Einen weiteren Hinweis auf Glaubensgemeinschaft sieht Martin Hein im R√ľckbezug der drei monotheistischen Religionen auf Abraham als Stammvater.
Aus dieser theologischen Perspektive ergeben sich f√ľr den Bischof weitreichende Konsequenzen. Er behauptet, dass die religi√∂sen bzw. theologischen Fragen als solche bereits eminent politisch sind und verweist u.a. auf ganz praktische Herausforderungen in der multikulturellen Gesellschaft, die gemeinsames Handeln erforderlich machen; so in Kindertagesst√§tten, Schulen und angesichts gro√üer gesellschaftlicher Krisen und Herausforderungen. Hier ist nach seiner Meinung gemeinsames Handeln im Sinne religions√ľbergreifender gottesdienstlicher Feiern w√ľnschenswert, ja sogar n√∂tig.
Das Feindbild aller Religionen sieht der Bischof im Fundamentalismus, der exklusiv den eigenen Wahrheitsanspruch gegen andere Religionen behauptet. Das w√ľrde n√§mlich zu einem Missionsverst√§ndnis f√ľhren, das auf Religionswechsel abhebt.
Damit liegt der Bischof ganz im Horizont der zivilgesellschaftlichen Erwartungen. Heins Zielsetzung f√ľr die christlichen Kirchen n√§hert sich damit entschieden dem Projekt einer Zivilreligion an, bei der im Hintergrund durchaus unterschiedliche Wahrheitsanspr√ľche stehen k√∂nnen. Die sind aber nicht so bestimmend, dass sich das gemeinsame Gebet und interreligi√∂se Gottesdienste verbieten w√ľrden.
2. Das Ja zur Persontoleranz
Im strikt politischen Sinne ist Martin Hein zuzustimmen: Wir leben in einer pluralen, offenen Gesellschaft, die ihre Freiheit und ihr friedliches Zusammenleben nur dadurch gew√§hrleisten kann, dass sie Menschen gegens√§tzlicher Religionen und Weltanschauungen duldet. Gefordert ist eine Toleranz, die den Respekt vor der Person des anderen praktiziert, auch wenn die Glaubensinhalte und ethischen Normen voneinander abweichen. Auf dieser Basis betont das Grundgesetz der Bundesrepublik auch die Trennung von Kirche und Staat. Das Grundgesetz steht damit im Horizont der europ√§ischen Aufkl√§rungstradition hinsichtlich der Menschenrechte und Religionsfreiheit. Kein biblisch orientierter Christ wird diese Form der Toleranz ernsthaft infrage stellen wollen. Und dies nicht lediglich aufgrund einer zu erwartenden politischen Correctness, sondern aus innerster theologischer √úberzeugung. Jesus hat nie einen Menschen zum Glauben gezwungen. Er hat seinen H√∂rern die Einladung Gottes ausgesprochen und ihnen deutlich die Wahrheit gesagt, allerdings so, dass er ihnen in jedem einzelnen Fall die pers√∂nliche Gewissensentscheidung freigestellt hat. Dass mit der Entstehung der ‚Äěchristlichen Reichskirche‚Äú unter Konstantin dem Gro√üen im 4. Jahrhundert die christlichen Kirchen dazu √ľbergegangen sind, nichtchristliche Minderheiten zu diskriminieren und zu disziplinieren und im schlimmsten Fall sogar mit politischer Gewalt zur Annahme christlicher Glaubens√ľberzeugungen zu zwingen, war ein fataler Irrweg, der mit dem Willen und praktischen Verhalten von Jesus Christus unvereinbar ist. Auf das Neue Testament kann sich also politischer Fundamentalismus keinesfalls berufen. Der Andersgl√§ubige darf nicht unter Druck gesetzt werden.
3. Dennoch bleibt es beim Missionsbefehl von Jesus
Aber von dieser Persontoleranz muss nun inhaltlich die Sachtoleranz unterschieden werden. Im Blick auf die Inhalte des Glaubens und ihr biblisches Profil kann und darf die Kirche nicht verzichten. Damit befinden wir uns n√§mlich auf einer anderen Argumentationsebene. Martin Luther, der in diesem Jahr 2017 besonders gefeiert wird, hat durch seine sog. Zwei-Regimenten-Lehre deutlich zwischen Kirche und Staat unterschieden. Der politische Bereich, in dem das Gesetz und das Gewaltmonopol des Staates gilt, ist jene Regierungsform Gottes, die der Erhaltung der Ordnung in der Welt und der Abwehr des Chaos dient. Ganz anders sieht die Sache in den Fragen des Glaubens aus. Hier kann nur durch das Wort ohne Gewalt dem Menschen die Einladung des Evangeliums weitergegeben werden. Das Evangelium ist allerdings auch mit der Ansage des J√ľngsten Gerichts verbunden. Jeder Mensch, ob Atheist, Moslem, Jude oder Christ, hat sich vor dem Richterstuhl Christi zu verantworten. Das ewige Heil wird ausschlie√ülich durch Jesus Christus geschenkt.
Im Horizont dieser Erkenntnis ist f√ľr die christliche Gotteslehre die Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist unverzichtbar. Der Glaube an den trinitarischen Gott geht weit √ľber den Monotheismus des Judentums und des Islam hinaus. Von daher ist die Behauptung, Muslime und Christen w√ľrden an einen gemeinsamen Gott glauben, irref√ľhrend und falsch. Nat√ľrlich erkennt die christliche Kirche im Gespr√§ch mit dem Islam an, dass Gott nur einer und ein Einziger ist. Diese √úberzeugung teilen wir als Kirchen vor allem auch mit dem Judentum. Aber um Gott wirklich kennenzulernen und in seiner N√§he zu leben, brauchen wir Christus, der uns mit Gott vers√∂hnt hat und uns die Liebe des Vaters offenbart hat. Deshalb ist es auch Auftrag aller Jesusj√ľnger, an Christi statt zu bitten: ‚ÄěLasst euch vers√∂hnen mit Gott!‚Äú (2Kor 5,20)
Gerade im Zusammenhang des Gebets zum trinitarischen Gott wird der Irrtum von Bischof Hein offenkundig. Wenn man die politische Gleichheit aller Menschen zusammenwirft mit dem Ziel der gottesdienstlichen Glaubensgemeinschaft, dann werden die tiefgreifenden Unterschiede zwischen Islam und Christentum verwischt. Und damit wird alles falsch.
√Ėkumenisch verweist Bischof Hein in seiner Argumentation auf Dokumente des II. Vatikanischen Konzils hin. Er √ľbersieht dabei die fundamentalen Unterschiede zu seiner eigenen interreligi√∂sen Konzeption. Die katholische Kirche hat in ihrem Lehrdokument ‚ÄěLumen Gentium‚Äú den allumfassenden Heilswillen Gottes allen Menschen gegen√ľber betont. Das kann man nur bejahen und unterschreiben; genauso auch den Hinweis des II. Vatikanums, dass wir als Christen das Gute und das Wahre in den verschiedenen religi√∂sen Kulturen anerkennen sollen. Das hat √ľbrigens in klaren Worten auch die evangelikale Bewegung 1974 in der Lausanner Verpflichtung so ausgesprochen. Schlie√ülich verweist die r√∂mische Kirche auf gemeinsame Traditionen zwischen Judentum, Christentum und Islam. Allerdings unter dem wichtigen Vorzeichen, dass die √úbereinstimmungen zwischen den Religionen als ‚Äěpraeparatio evangelica‚Äú, d.h. als Vorbereitung auf das Evangelium zu verstehen sind. In diesem Sinne bejahen evangelikale Christen durchaus den interreligi√∂sen Dialog, n√§mlich als Weg des respektvollen gegenseitigen Kennenlernens; aber eben mit der unabdingbaren Zielsetzung, Menschen ‚Äď soweit sie durch ihre religi√∂sen Erkenntnisse von Gott auf die Botschaft des Evangeliums vorbereitet sind ‚Äď ausdr√ľcklich und tats√§chlich zu Christus einzuladen.
Indem Bischof Hein die Frage der theologischen Wahrheit in einen unl√∂sbaren Zusammenhang von politischer Toleranz stellt, hebt er nicht nur eine Grundeinsicht des Neuen Testaments, sondern auch der Reformation auf. Diese Haltung erweist sich vor allem darin als fatal, dass sie die Bereitschaft, missionarisch zu Christus einzuladen, verdunkelt und schw√§cht. So bleibt am Ende einzig die Offenheit des interreligi√∂sen Gespr√§chs und des Austauschs von verschiedenen religi√∂sen √úberzeugen. Aber es wird nicht mehr klar artikuliert, worin der Auftrag der Christen wirklich besteht, n√§mlich im Ruf zu Christus, und zwar gegen√ľber allen Menschen in Deutschland, d.h. den Atheisten, den Muslimen und den s√§kularisierten Kirchenmitgliedern. Die Kirchen haben die gro√üe Chance im Sinne der Demokratie, auf dem Recht der Religionsfreiheit zu bestehen; inklusive des Rechts zum Religionswechsel. Es gilt allen Menschen, die biblische Botschaft von Christus als dem einzigen Retter der Welt weiterzusagen.
Dr. Rolf Hille, 4.1.2017
Quelle: www.bibelundbekenntnis.de
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Dienstag 10. Januar 2017 um 9:03 und abgelegt unter Kirche, Theologie, Weltreligionen.