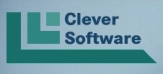Impulse für eine Wachsende Kirche
Dienstag 1. April 2008 von Dr. Johannes Zimmermann

Impulse für eine Wachsende Kirche
Einführung
„Die Möglichkeit also, aus einem unchristlich gewordenen Milieu neue Christen zu gewinnen, ist der einzig lebendige und überzeugende Beweis dafür, daß das Christentum auch heute noch eine wirkliche Zukunftschance hat“. Deshalb soll die Kirche den „Schwerpunkt auf eine offensive Haltung für die Gewinnung neuer Christen aus einem ‘unchristlichen’ Milieu legen und nicht auf eine defensive Verteidigung ihres traditionellen Bestandes“.
Das steht nicht im Programm von „Wachsende Kirche“, das sind Worte, die einer der bedeutendsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts, Karl Rahner, 1972, also vor über 30 Jahren äußerte (Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance, 36+35).
Nochmals O-Ton Karl Rahner: „Der beste Missionar in einer nichtchristlichen Diasporasituation wäre der beste Kandidat für ein kirchliches Amt“ (ebd., 37).
Für „wachsende Kirche“ sind solche Sätze wichtig, weil es hier um die Wachstumsfähigkeit der Kirche geht. Wachstumsfähigkeit bedeutet Zukunftsfähigkeit. Zukunftsfähig ist eine Kirche dann, wenn es ihr gelingt, nicht nur den Glauben von einer Generation an die andere weiterzugeben – schon das ist viel und eine zentrale Aufgabe. Aber erst wenn unser Blick über Kirchenmauern hinweg geht, entspricht die Gemeinde Jesu Christi ihrem Auftrag. Schließlich ist sie ja nicht nur an die Kirchentreuen gewiesen, sondern auch an die Kirchenfernen und Konfessionslosen.
Ich möchte heute versuchen, einige Impulse für den Prozeß „Wachsende Kirche“ zu geben. Ich möchte Themen anreißen, die nach meiner Einschätzung wichtige Grundlagen für eine wachsende Kirche sind. Es geht also nicht um fertige Konzepte, sondern um Grundlagen, die es dann vor Ort umzusetzen gilt. Dabei sindhantasie und Kreativität gefragt.
1. Inkulturation und Konterkulturation des Evangeliums
2. Elementare Schritte auf dem Weg zum Glauben
3. Zielorientierung im Gemeindeaufbau
4. Zur Soziologie des Wachstums
5. Die Frage nach der „pastoralen Strategie“
1. Inkulturation und Konterkulturation des Evangeliums
„Inkulturation“, in der evangelischen Theologie auch Kontextualisierung genannt, ist ein Stichwort aus der Missionswissenschaft. Ausgangspunkt der Inkulturation ist letztlich die Inkarnation: in unser armes Fleisch und Blut / verkleidet sich das ewig Gut (EG 23,2). Gott wird Mensch, weil er uns Menschen nahe kommen will. Von daher ergibt sich unsere Aufgabe: den Menschen, die Gott liebt, nahe zu kommen und ihnen in ihrer Lebenswelt zu begegnen.
In der Mission in Übersee ist die Aufgabe der Inkulturation einleuchtend: Wenn ich in einem fremden Land andern Menschen mit einer mir fremden Kultur das Evangelium zugänglich machen möchte, dann muß ich zunächst ihre Kultur und Sprache kennenlernen: die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, ihr Leben gestalten, auch, wie sie miteinander feiern und vieles andere mehr. Das erfordert enorme Anstrengungen, die Jahre dauern können. Aber nur so können andere das Evangelium verstehen und merken: Es ist nicht nur eine Sache für Mitteleuropäer, es gilt auch uns. „Inkulturation“ heißt: sich um eine kulturellen Gestalt des Evangeliums mühen, die dem Leben und Erleben der Menschen entspricht. Das Evangelium soll verständlich sein und zugleich als Herausforderung erkannt werden.
Mittlerweile können wir auch im Missionsland Deutschland nicht mehr darauf verzichten. Auch bei uns ist es unerlässlich zu fragen: Wie denken die Menschen in unserer Umgebung? Was beschäftigt sie? Auch bei uns gilt: Jedem soll das Evangelium in seiner Kultur zugänglich sein. Mit „Kultur“ meine ich hier Lebensgewohnheiten und Lebensweisen im weitesten Sinne. In dieser Hinsicht besteht ein kultureller Graben zwischen Konfirmanden und zwischen der älteren Generation, die vielerorts den Großteil der Gottesdienstbesucher ausmacht. Es wäre schade, wenn ein Konfirmand das Evangelium nur in der ihm meist fremden kulturellen Gestalt eines traditionellen Gottesdienstes kennenlernen würde!
Unsere traditionelle Kirchlichkeit ist nicht die Urform des Evangeliums. Das Evangelium begegnet uns immer in einer bestimmten kulturellen Form. Es gibt das Evangelium nicht „pur“, sondern immer nur in kulturell geprägten Formen. Zugleich müssen wir zwischen dem Evangelium und seiner kulturellen Form unterscheiden.
Ich kenne und schätze die traditionelle kulturelle Form unserer Kirche: Die Lieder des Gesangbuchs, Orgelmusik, Gottesdienste mit einer festen Liturgie, die vom regelmäßigen Nachvollzug lebt, tiefgründende Predigten. Aber für viele, besser: die meisten unserer Zeitgenossen ist diese kulturelle Einbindung des Evangeliums fremd geworden. Das gilt schon von den sog. Distanzierten, noch mehr für Menschen in konfessionslosen und atheistischen Milieus.
Ich kann nun nicht von meinen Zeitgenossen verlangen, daß sie sich zuerst zu einer bestimmten kulturellen Form bekehren müssen, damit ihnen das Evangelium verständlich und einleuchtend wird. Ich kann nicht von Konfirmanden verlangen, daß sie zuerst Orgelmusik, Bachkantaten und traditionelle Gottesdienste schätzen müssen, damit sie Zugang zum Evangelium bekommen. Das wäre, wie wenn ein Missionar die Sprache Luthers unterrichtet, damit Menschen in Papua-Neuguinea die Lutherbibel lesen können und das Evangelium verstehen.
Hier kommt die Aufgabe der Inkulturation zum Zuge: Wie kann das Evangelium in einer kulturellen Form, in einem kulturellen Umfeld zum Ausdruck kommen, der den Menschen, mit denen ich lebe, vertraut ist? Eine Verweigerung der Inkulturation wäre lieblos, denn das würde bedeuten, Hürden zu errichten, die Menschen erst überwinden müssen, um Zugang zum Evangelium zu bekommen.
Auf der anderen Seite gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen der Inkulturation in der Mission und der Inkulturation in unseren Gemeinden: In der Mission erfolgt die Inkulturation in der Regel in eine mir fremde Kultur, während wir an den Kulturen und Lebenswelten der Menschen in unserem Land in der Regel teilhaben: Die Musik, die sie hören, hören auch wir im Radio und anderswo. Das erleichtert die Aufgabe der Inkulturation, aber es erübrigt sie nicht.
Eines der derzeit bekanntesten Beispiele für den Versuch einer gottesdienstlichen Inkulturation des Evangeliums sind die Gästegottesdienste von Willow Creek, die sog. „Seeker-Services“. Hier wird nicht gefragt: Wie ist uns das Evangelium vertraut?, sondern: Wie können wir es Kirchendistanzierten in einer Form nahe bringen, die ihnen vertraut ist und die sie verstehen können? Er geht deshalb radikal vor, weil er sich an Menschen wendet, denen die Veranstaltungsform „Gottesdienst“ nichts mehr sagt.
Wo Menschen noch einen Begriff und eine Ahnung von „Gottesdienst“ haben, wird eine Inkulturation anders aussehen: Da bedarf es einer verantwortungsvollen Vermittlung zwischen der Tradition und den Rezeptionsgewohnheiten der Menschen, die in diesem Gottesdienst dem lebendigen Gott begegnen sollen. Die Aufgabe ist: Gottesdienste so gestalten, daß für jeden die Bedeutung des Evangeliums in seiner Situation verständlich und erkennbar wird, daß ihnen der Gottesdienst „etwas sagt“. Wie das aussieht, erfahre ich nur im Gespräch, im Dialog mit ihnen. Viele der Zweitgottesdienste verstehe ich als solche Bemühungen um Inkulturation.
Rede ich damit einer Anpassung das Wort? Soll Kirche alles machen und anbieten, Hauptsache, es kommt an? Keineswegs. Die Inkulturation ist nur die eine Seite. Daneben tritt die Aufgabe der Konter-Kulturation: Das Evangelium soll eingehen in die Lebenswelten unserer Zeit und in diesen als etwas anderes, davon zu Unterscheidendes zum Leuchten kommen.
Aufgabe der christlichen Gemeinde ist es nicht nur, nahe an den Menschen dran zu sein, sondern auch ein klar erkennbares Profil zu haben. Während die Inkulturation dafür steht, daß das Evangelium in eine Kultur eingeht, steht die Konter-Kulturation für die bleibende Unterschiedenheit zu dieser Kultur.
Es geht also nicht um Anbiederung. Es geht nicht nur darum, das Evangelium in einer andere kulturelle Form eingeht, sondern immer auch darum, daß es in dieser Kultur als etwas wahrgenommen wird, was sich von dieser unterscheidet, als Herausforderung, als Ruf zur Umkehr.
Das Ziel ist es, daß die jeweilige Kultur vom Evangelium her neu gestaltet und verändert wird. Wo Menschen gleichgültig bis ablehnend sind, da kann das damit zu tun haben, daß uns Christen nicht verheißen ist, daß wir nur Zustimmung ernten werden. Wir sollten uns allerdings fragen, ob es wirklich das Wort vom Kreuz ist, das Ablehnung erfährt – oder ob es nicht vielmehr die kulturelle Form ist, in der andern das Evangelium begegnet.
2. Elementare Schritte auf dem Weg zum Glauben
In der EKD-Schrift „Das Evangelium unter die Leute bringen“ von 2001 ist zu lesen: „Es gibt viele Wege, der Einladung zum Glauben zu folgen … Neben dem „Damaskusweg“ einer plötzlichen Lebenswende und der allmählichen Veränderung des Lebens auf dem „Emmausweg“ gibt es auch den „Bartimäusweg“, wenn aus der diakonischen Erfahrung von Hilfe und überraschend erfahrener Liebe Vertrauen zu Jesus Christus erwächst“ (Das Evangelium unter die Leute bringen, 19).
Diese Sätze kann ich nur unterstreichen. Die schöpferische Vielfalt Gottes endet nicht mit der Schöpfung. Es ist nicht so, daß im Bereich der neuen Schöpfung die Vielfalt einem einheitlichen Grau Platz machen würde. Wie im Bereich der kreatürlichen Schöpfung, so sind auch im Bereich der Neuschöpfung Wachstumsprozesse eine höchst individuelle Sache. Gott kennt nicht nur „Schema F“. Oder, mit dem Grafen Zinzendorf: Die Wege des Heilands „mit den Seelen sind in der Tat different“.
Und doch: Wo nur die Vielfalt betont wird, fehlt etwas. Vielfalt und Individualität ist ja nur die eine Seite. Wo mir die Verantwortung aufgetragen ist, Menschen auf solchen Glaubenswegen zu begleiten, da ist es grundlegend, nicht nur zu wissen und zu bejahen, daß es eine Vielfalt gibt, sondern auch die Gemeinsamkeiten in der Vielfalt zu kennen. Ohne hinter die Vielfalt zurückzukehren wollen: Wo es darum geht, Wege zum Glauben verantwortlich zu gestalten, ist es nötig, darüber hinaus zu fragen, wie ein Weg zum Glauben in elementaren Schritten aussehen kann. Es ist die Frage nach dem, was das Gemeinsame und Verbindende in der Vielfalt ist. Es genügt eben nicht, die Unverfügbarkeit von Glaubensentwicklungen zu betonen, wir brauchen Hilfen zur verantwortlichen Gestaltung und Begleitung.
Ein solcher Versuch der Elementarisierung stammt aus Rom. Papst Paul VI. war es 1975, der in seinem bis heute bedeutsamen Apostolischen Mahnschreiben „evangelii nuntiandi“ einen solchen Weg in fünf elementaren Schritten vorschlug. Eben diese fünf Schritte wurden im Schreiben der Deutschen Bischofskonferenz „‘Zeit zur Aussaat’. Missionarisch Kirche sein“ (2000) wieder aufgegriffen. Dort werden fünf „Stufen auf dem Glaubensweg“ genannt:
1. Zeugnis des Lebens
2. Zeugnis des Wortes
3. Zustimmung des Herzens („Die Botschaft des Evangeliums will gehört, aufgenommen und angeeignet werden, sie sucht die Zustimmung der Herzen der Menschen zur Wahrheit des Glaubens“)
4. Eintritt in eine Gemeinschaft von Gläubigen
5. Beteiligung am Apostolat – selbst in die Sendung eintreten.
Ich verstehe das nicht als ein festes und unabänderliches Schema, sondern als einen Versuch, den Weg zum Glauben und in die Gemeinde in elementaren Schritten zu beschreiben und zu gestalten.
Die Notwendigkeit, einen Weg in solchen elementaren Schritten zu gestalten, erwächst daraus, daß der Weg zum Glauben nur selten ein punktuelles Ereignis ist. Sicher, es gibt auch die radikale Kehrtwende. Aber in den meisten Fällen ist der Weg zum Glauben ein Prozess, ein Weg, auf dem Menschen Begleitung brauchen. Es geht nicht darum, Menschen in eine bestimmte Richtung zu drängen. Auf keinen Fall darf es dazu kommen, daß etwa Freundschaften instrumentalisiert werden. Vielmehr geht es darum, mit Menschen, die offen sind, einen Weg zu gehen, sie nicht allein zu lassen, sondern ihnen Brücken zu bauen, die weiterführen. Die Herausforderung besteht darin, sensibel einen solchen Weg zu gestalten, der Zeit lässt und Zeit gibt. Ein solcher Weg kann nach jedem Schritt abbrechen. Die elementaren Schritte sollen nicht zu einem Schema führen, sondern eine Ahnung davon vermitteln, wie so ein Weg beginnen und weiterführen könnte. Es ist selbstverständlich, daß sie flexibel zu handhaben sind. Was sich z. B. immer häufiger findet, ist, daß jemand zuerst in einer Gemeinschaft von Gläubigen eintritt, und erst dort sein Glaube heranwächst. Robin Gill nennt das Belonging before believing. Dadurch, daß jemand aufgenommen wird, dazugehören darf, vielleicht sogar Aufgaben übertragen bekommt, wächst Glaube heran.
Als solche Glaubenswege en miniature können Glaubenskurse angesehen werden, ob das nun der Alphakurs, der Emmauskurs, oder der „Klassiker“ Christ werden – Christ bleiben“ ist. Am Anfang steht die Atmosphäre, die freundliche Aufnahme. Dann folgt das „Zeugnis des Wortes“, angelegt darauf, beim Einzelnen Zustimmung zu wecken, ihn hineinzuführen in eine Gemeinschaft von Glaubenden, mit dem Ziel, daß er seine Begabungen und Berufungen entdeckt und ausübt. Dazu wird ein Weg angeboten, der sich über mehrere Wochen erstreckt.
3. Zielorientierung im Gemeindeaufbau
3.1. Die Notwendigkeit einer Gesamtkonzeption
Wie können wir unsere Gemeinde so gestalten, daß sie zu einem wachstumsfördernden Umfeld für den Einzelnen wird? Das ist eine der zentralen Fragen des Gemeindeaufbaus, der Gemeindeentwicklung – und dabei geht es um weit mehr als um eine rein organisatorische Strategie!
Wenn etwas Dauerhaftes daraus erwachsen woll, benötigen Projekte und Aktionen die Einbettung in eine Gesamtkonzeption des Gemeindeaufbaus. Er braucht sozusagen „flankierende Maßnahmen“, ein „davor“ und ein „danach“. Purer Aktionismus hilft nicht weiter. So nach dem Motto: Wir sollten mal wieder etwas unternehmen. Und dann wird ein Projekt aus dem Boden gestampft: Hier eine Musiknacht, dort eine Gemeindefreizeit, wieder woanders eine Evangelisation. Das können alles gute und hilfreiche Dinge sein. Allerdings stehen isolierte Aktionen unter der Gefahr, daß ihre Wirkungen schnell verpuffen. Besser ist es, die einzelnen Aktionen und Projekte als Teil des Gemeindeaufbaus zu sehen. Dabei muß die Frage nach der Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen. Zur „Wachsenden Kirche“ gehört es, nicht nur kurzatmige Erfolge anzustreben, sondern sich um Beständiges und Dauerhaftes zu mühen.
Ich nehme das Beispiel Zweitgottesdienste. Wie könnte da ein „davor“ und „danach“ aussehen?
Ich versuche ein Beispiel: Da hat eine Gemeinde über einen Mutter-Kind-Kreis Kontakte zu jungen Familien. Wenn man nun gleich kommen würde und sagen: die könnten wir in Hauskreise einladen, dann wäre das für die meisten eine Überforderung. Man könnte sie hingegen zu Familiengottesdiensten oder zu Zweitgottesdiensten einladen. Für diejenigen, die regelmäßig kommen und Interesse zeigen, wäre ein nächster Schritt beispielsweise ein Glaubenskurs. In der Weiterführung eines Glaubenskurses könnten dann ein Hauskreis und schließlich die Mitarbeit in der Gemeinde stehen. Wichtig ist dabei: Es soll ein Weg sein, der Zeit lässt und Zeit gibt. Niemand soll zum jeweils nächsten Schritt genötigt werden.
Was heißt das nun für eine Gemeinde insgesamt? Das heißt keineswegs, daß man den Altenclub verbieten und den Dritte-Welt-Laden vor die Tür setzen sollte. Aber wenn es um die Frage geht, wo Schwerpunkte gesetzt, wo Kräfte investiert und wo Neues begonnen werden sollte, sollte nicht das Zufallsprinzip regieren oder die Steckenpferde des Pfarrers den Ton angeben, hier geht es um ein stimmiges Konzept. Schwerpunktsetzungen sind nötig, denn wer alles gleichmäßig weiterführen will, steht in der Gefahr, sich zu verzetteln.
Dazu ein schönes Beispiel von Herbert Lindner. Er setzt an bei der „Zielorientierung auf das Glaubensthema“. Diese bedeutet keineswegs, „nur ‘rein’ religiöse Themen anzubieten“. „Kochkurse in der Gemeinde? Streichen oder jedenfalls die Finger davon lassen? Was macht den Kochkurs zum legitimen Angebot einer Kirchengemeinde: Daß „biblische Speisen“ gekocht werden? Daß die Fragen nach dem Lebensstil und der ökologischen Verantwortung zur Sprache kommen? Daß in den Kochpausen und beim Gemüseschneiden die kleinen und großen Alltagsprobleme zur Sprache kommen? Daß Verbindungen geknüpft werden, die tragfähig sind, wenn existentielle Fragen aufbrechen? Daß Fragen der familiären Rollenverteilung besprochen und geklärt werden? Daß das Abschlussessen des Kurses in eine Agape mündet? Daß die Rezepte der in der Gemeinde wohnenden Ausländer mit diesen zusammen erarbeitet werden und das Ergebnis eine große Einladung im Gemeindehaus zum ersten Advent oder in der Woche der ausländischen Mitbürger ist?“ Ich könnte noch ergänzen: Daß vor dem Essen ein Tischgebet gesprochen wird und es am Ende eine Andacht gibt?
Am diesem Beispiel verdeutlicht Lindner, „daß viele Angebote Medien für erweiterte Inhalte sein können. Auf den Kontext kommt es an und auf den Rahmen, in den dieses Angebot gestellt wird … [D]ie Mittel, die eine evangelische Kirchengemeinde verwendet, sind nicht absichtslos, sondern sie dienen einem Ziel. Die Ziele für dieses Mittel müssen mit den Gemeindezielen übereinstimmen und ausdrücklich gemacht werden. Es muß beschreibbar sein, auf welchen Wegen dieses Mittel die Chance besitzt, die angestrebten Ziele zu erreichen. Es genügt nicht, allgemeine Erwartungen und eventuelle Möglichkeiten zu beschreiben, um Dinge zu tun, die eben mal Resonanz versprechen“ (Kirche am Ort. Ein Entwicklungsprogramm für Ortsgemeinden, 2. Aufl. 2000, 139).
Für eine wachsende Kirche ist es wichtig, sich zu überlegen, wie die einzelnen Bausteine zusammenpassen und zusammenwirken sollen, daß eine Gemeinde insgesamt zu einem glaubensfördernden Umfeld wird. Das kann bei jeder Gemeinde wieder anders aussehen. Ich plädiere hier nicht für ein Einheitskonzept, sondern dafür, zu fragen, was in der jeweiligen Situation mit den vorhandenen Kräften und Mitarbeitern das Angemessene und Weiterführende sein kann.
Das spricht auch dafür, zu fragen, wie die einzelnen Aufgabenfelder und Aktivitäten einer Gemeinde zusammengehören. Viele Gemeinden haben gute Erfahrung mit der Erstellung eines Leitbildes, mit der Formulierung von Gemeindezielen oder mit einer Perspektivplanung gemacht. Die Absicht hinter ist klar: Eine Gemeinde, die einen gemeinsamen Auftrag erkennt und wahrnimmt, muß auch das Ziel und die Grundlage dieses Auftrags nennen können. Wenn man nur sagt: Wir wollen doch alle daßelbe, aber jeder wieder etwas anderes darunter versteht, wird das nicht gelingen.
3.2. Das „Klima“ einer Gemeinde
Die Einbettung in den Gemeindeaufbau ist das eine. Es wäre verfehlt, zu meinen, man bräuchte nur das richtige Konzept und die richtige Strategie, dann würde alles klappen. In unseren Gemeinden geht es um Menschen, und das heißt auch, daß es „menschelt“. Sie werden alle Fälle kennen, wo ein Pfarrer und eine Gemeinde zusammenfinden, die theologisch-geistlich zusammenzupassen und sich auch einig sind in der Zielsetzung für die Gemeindearbeit – und das Ganze geht dann deshalb schief, weil es im menschlichen Miteinander zu Zerwürfnissen kommt.
Ein gutes Konzept ist wichtig, aber es hilft allein nicht weiter, wenn gleichzeitig die Mitarbeiter gegängelt und ausgebremst werden. Wenn ein Kirchengemeinderat alle Ideen des Pfarrers blockiert oder wenn umgekehrt ein Pfarrer nie gelernt hat, im Team zu arbeiten. Mitarbeiter in einer Gemeinde brauchen ein Umfeld, in dem sie Anerkennung finden, in dem sie sich entfalten können und gefördert werden. Das Miteinander, die Umgangsformen – die Atmosphäre, das Klima einer Gemeinde muß stimmen, damit eine Gemeinde wachsen kann. Es ist wie beim Wein: Guter Wein gedeiht nicht in jedem Klima, er braucht ein bestimmtes Klima, um wachsen zu können.
3.3. Die „Körpersprache“ einer Gemeinde
Zur Frage nach dem Klima tritt diejenige nach der „Körpersprache“. Wir können durch Gestik und Mimik einander mit unserem Körper Zeichen geben, ohne viel zu reden. Das geschieht oft unbewusst. Schwierig wird es dann, wenn das Gesagte und die Körpersprache nicht zusammenpassen, sondern einander widersprechen. Das sorgt für Irritationen.
Genauso ist es bei der „Körpersprache“ einer Gemeinde. Gemeint ist die Frage: Welche Signale sendet unsere Gemeinde nach außen? Wie werden wir im Ort von andern wahrgenommen? Als ein abgeschlossener Kreis mit hoher Nestwärme, aber unzugänglich für andere? Wenn das so ist, hilft alles Reden über Offenheit und Mission nichts. Dann redet die „Körpersprache“ der Gemeinde stärker als die Worte. Hören neu Dazukommende zwar ein „schön, daß du da bist“, aber spüren dann bald, daß sie kaum eine Chance haben, in das „Innere“ einer Traditionsgemeinde vorzustoßen? Ich freue mich immer, wenn ich in eine Gemeinde komme, wo ich spüre: „Körpersprache“ und Worte passen zusammen. Wo ich denke: In so einer Gemeinde könnte ich mir gut vorstellen, mit unserer Familie zu wohnen.
Während ich mit dem Stichwort „Klima“ die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde im Blick hatte, zielt die „Körpersprache“ nach außen. Ich komme damit zum Auftrag der Gemeinde, zu ihrem missionarischen Auftrag. Der beginnt damit, daß eine Gemeinde sich nicht selbst genug ist, sondern sich nach außen hin öffnet. Sich öffnet in ihren Bemühungen um Inkulturation des Evangeliums, sich öffnet in der Absicht, anderen einen Weg hin zum Glauben und in die Gemeinde zu eröffnen.
Das ist dort der Fall, wo eine Gemeinde fragt: Was sind das für Menschen, mit denen wir zu tun haben? Was treibt sie um, was bewegt sie? Welche Sorgen und Nöte beschäftigen sie? Wo eine Gemeinde so fragt, findet Kommunikation nach außen statt. Da wird eine Gemeinde verändert. Da kommt eine Kerngemeinde heraus aus dem abgeschlossenen Milieu einer kirchlichen Subkultur. Auch das ist unabdingbar für eine „Wachsende Kirche“.
4. Zur Soziologie des Wachstums
Was fördert das Wachstum des Glaubens, was erschwert es? Vorhin sprach ich vom Klima einer Gemeinde. Jetzt frage ich: In welchem „Humus“ gedeiht Glaube? Welche Faktoren tragen dazu, daß die Weitergabe des Glaubens gelingt, welche erschweren sie? Das gilt sowohl für die Weitergabe von Generation zu Generation als für die missionarische Weitergabe.
Ich steige ein mit einer Beobachtung des Bielefelder Soziologen Franz-Xaver Kaufmann: „Es war in der Vergangenheit nie in erster Linie die kirchliche Organisation als solche, welche die Tradierung christlicher Sinngehalte auf die folgende Generation zu leisten hatte. Die Gewinnung neuer Christen durch die Erziehung der Kinder im christlichen Geiste erfolgte vermittelt durch jene sozialen Gruppen, denen die Kinder angehörten: die Familie, die Verwandtschaft, die Nachbarschaft, die Schule und … die Jugendgruppen … Wenn dagegen sozusagen alles, was mit Religion zu tun hat, von den Kirchen und deren amtlichen Vertretern erwartet wird, … wenn in Familien und im Freundeskreis über religiöse und moralische Fragen nicht mehr gesprochen wird, so sind die Chancen der religiösen Sozialisation und damit die Tradierungschancen des Christentums … erheblich reduziert“ (Kirche begreifen, 1979, 133f).
Die Ergebnisse lassen sich so zusammenfassen: „Wenn es zutrifft, daß Wertorientierungen nur über die Identifikation mit Gruppen oder Personen erworben werden können, so gibt es aus erfahrungswissenschaftlicher Sicht eigentlich nur zwei Wege, um zu einem in theologischer Hinsicht qualifizierten Glauben zu gelangen: entweder die länger dauernde Einbindung in religiös motivierte Gruppen oder die Identifikation mit Personen, die als Vorbilder erfahren werden“ (Religion und Modernität, 1989, 226).
Überlegen Sie einmal, was für Sie auf dem Weg zum Glauben wichtig war. Ich bin überzeugt, daß es eben diese Faktoren waren: „die länger dauernde Einbindung in religiös motivierte Gruppen oder die Identifikation mit Personen, die als Vorbilder erfahren werden“ – oder im besten Fall beides.
Das gilt für die Weitergabe des Glaubens von Generation zu Generation ebenso wie für Mission. „Wachsende Kirche“ wird darauf bedacht sein, soziale Kontexte zu schaffen und zu fördern, in denen Glaube Wurzeln schlagen kann, in denen er gefördert wird und sich entfalten kann. Die Ortsgemeinde ist dazu oft zu groß und unüberschaubar. Deshalb brauchen wir Formen, die zwischen der Kleinfamilie und der Ortsgemeinde liegen. Jugendgruppen, Hauskreise, Zellen, Nachfolgegruppen, Gemeinschaften und andere „Biotope des Glaubens“.
„Wachsende Kirche“ wird hier darauf achten, daß Glaube in der Gemeinschaft des Glaubens beheimatet wird. Daß er ein Umfeld bekommt, in dem er gestützt und gefördert wird. Der Soziologe Peter L. Berger nennt das eine „Plausibilitätsstruktur“: ein soziales Umfeld, in dem Glaube plausibel bleibt.
Das ist aber nur die eine Seite. Es wäre wenig gewonnen, wenn alle Christen sich in christlichen Grüppchen einigelten und von der bösen Welt abschotteten. Christen haben den Auftrag, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Glaube bewährt sich gerade in der „Diaspora“ dieser Welt. Wir brauchen deshalb „diasporafähigen“ Glauben. Das heißt, wir brauchen die Gemeinden als „glaubensförderndes Umfeld“ – ein Umfeld, in dem Glaube so gefördert und gestärkt wird, daß er auch im Alltag, in der Minderheitensituation tragfähig ist.
Eine solche soziologische Betrachtung steht nicht im Gegensatz zu einer theologischen. Beide Betrachtungsweisen ergänzen einander vielmehr und treffen sich nicht zuletzt darin, daß Glaubensvermittlung letztlich unverfügbar ist. Ich bin der Überzeugung, daß der Heilige Geist in diesen und durch diese soziologisch beschreibbaren Prozesse am Wirken ist. Sein Wirken ist zwar nicht auf diese Prozesse beschränkt, aber in der Regel bedient sich der Heilige Geist solcher der durch die Schöpfung gegebener Strukturen. Zu einer verantwortlichen Wahrnehmung des missionarischen Auftrags gehört es deshalb auch, diesen Prozessen Beachtung zu schenken – nicht um einer Ideologie der Machbarkeit zu huldigen, sondern im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes in, mit und unter sozialen Prozessen.
5. Zur Frage der „pastoralen Strategie“
Wie können die eben geäußerten Gedanken zur Soziologie des Wachstums in einem volkskirchlichen Kontext umgesetzt werden? Da gibt es ja noch eine Reihe weiterer Aufgaben und Verpflichtungen, denen wir uns nicht einfach entziehen können. Welche „pastorale Strategie“ ist hier angemessen? Ich greife dabei zurück auf Gedanken des römisch-katholischen Theologen Medard Kehl aus St. Georgen bei Frankfurt zurück (Welche „pastorale Strategie“ braucht die deutsche Kirche heute?, 2003). Kehl unterscheidet zwei „pastorale Grundimpulse“: Eine „Pastoral mit Breitenwirkung“ und eine „Pastoral der Dichte bzw. Intensität“.
5.1 Aufgabe der „Pastoral mit Breitenwirkung“ ist es, „die Präsenz des christlichen Glaubens in seiner humanisierenden Kraft gesamtgesellschaftlich lebendig [zu] erhalten“. Kirchen sind wichtig „als ernst zu nehmender Gesprächs und Koalitionspartner im öffentlichen Leben und im Leben der einzelnen Glieder“. Wir brauchen die Präsenz des christlichen Ethos in der Friedensfrage, der Frage der wirtschaftlichen Globalisierung, der medizinischen Nutzung der Gentechnik usw. Wir brauchen eine Kirche, die sich hier qualifiziert und kommunikativ einbringt.
Dann gehört zur Pastoral mit Breitenwirkung die „Kirche als religiöse Dienstleistungsgesellschaft“. Kehl redet von „kultureller Diakonie“ und meint das, was traditionell mit „Volkskirche“ bezeichnet wird: Diejenigen kirchlichen Handlungen, die den größten Teil der Kirchenmitglieder erreichen: Kindergärten, Religions- und Konfirmandenunterricht, Diakonie und Seelsorge und vor allem die Kasualien. Kurzum: Diejenigen Angebote, die weithin pfarramtlich versehen werden, die von fast allen Kirchenmitgliedern in Anspruch genommen werden und daher auch als Dienstleistungen betrachtet werden können.
5.2 Der „Pastoral mit Breitenwirkung“ gegenüber steht der zweite pastorale Grundimpuls, die „Pastoral der Dichte“ bzw. Intensität.
Hier geht es vor allem darum, Das wachsende „Netzwerk“ verschiedenster „kommunikativer Glaubensmilieus“ kirchlicherseits aktiv zu fördern. Mit „kommunikativen Glaubensmilieus“ meint es das, was die katholischen deutschen Bischöfe „Biotope des Glaubens“ nennen. Es geht um Gruppen, Gemeinschaften, geistliche Bewegungen. Evangelisch gesprochen: um alles von der Basisgemeinde bis zum Hauskreis.
Diese „Glaubensmilieus“ sollen nach Kehl „als öffentlich erkennbare Sozialform von Kirche“ ein Gegengewicht zur Kirche als „Dienstleistungsgesellschaft“ bilden, indem sie eine kirchliche „Eigenkultur“ (nicht „Gegenkultur“!) aufzubauen versuchen und damit der Kirche zu einer profilierteren Identität verhelfen. „Diese lebendige Form von ‚Gemeinschaft im Glauben’ kann der Kirche im Ganzen wirksam zu ihrer kulturell wahrnehmbaren Identität als Kirche Jesu Christi, als Volk Gottes und als Zeichen der Liebe Gottes verhelfen“.
Mit meinen Worten: Kirche kann nicht nur aus vom Pfarrer erbrachten Dienstleistungen bestehen. Kirche ist zunächst und vor allem Gemeinschaft der Glaubenden (communio sanctorum). Das macht ihre Identität aus – und das soll deshalb auch die Gestalt der Kirche prägen. In ihrer Form soll der Glaube als lebensprägende und gemeinschaftsstiftende Kraft anschaulich werden.
Lassen Sie es mich als Frage formulieren: Was für eine Anschauung haben unsere Zeitgenossen vom christlichen Glauben? Fällt ihnen zuerst die Kirche als Organisation ein, der Pfarrer, der Gottesdienste und Konfirmandenunterricht hält, der Kinder tauft und Verstorbene beerdigt? – Oder denken sie da an Menschen, die gemeinsam ihren Glauben leben, deren ganzes Leben davon geprägt ist, die glaubwürdig sind und etwas ausstrahlen?
5.3. So weit die Gegenüberstellung. Auch wenn meine letzten Worte schon eine klare Tendenz hatten, geht es nun nicht darum, das eine zu tun und das andere zu lassen. Vielmehr kommt es darauf an, beide Grundimpulse zu vernetzen, damit sie sich gegenseitig ergänzen. Medard Kehl formuliert das so: „Meine spezifische Option: Den Hauptakzent unserer Pastoral verlagern auf den zweiten Grundimpuls – allerdings nur im offenen und weiten Horizont des ersten“.
Er begründet das so: Der erste Grundimpuls ist das, was die Kirche bei uns quasi immer schon tut. Das ist man von ihr gewohnt und das erwartet man von ihr. „Der zweite Grundimpuls dagegen bedarf heute einer ganz bewussten Entscheidung; denn inmitten einer Kultur, die sich zunehmend desinteressiert an den spezifisch christlichen Inhalten unseres Glaubens und auch an einer verbindlichen gemeinsamen Lebensform im Glauben zeigt, muß sich das Volk Gottes bewusst und gegen den kulturellen Sog seiner gemeinsamen Glaubensidentität stärker vergewissern“. Nicht indem sie sich abkapselt, sondern in Offenheit für alle Menschen. Soweit Kehl.
Um zu verdeutlichen, daß die „Pastoral mit Breitenwirkung“ in der gegenwärtigen Situation allein nicht zu einer zukunftsfähigen Gemeinde führt, verweise ich gerne auf die Erfahrungen von Eberhard Winkler aus Halle: „Kasualien und Religionsunterricht werden auf die Dauer nicht ausreichen, die ‘Christen in Halbdistanz’ in der Kirche zu halten. Wir haben in der DDR erlebt, wie schnell eine Kasualkirche zusammenbrechen kann“ (Eberhard Winkler, Tore zum Leben, 1995, 34).
5.4. In der Frage nach dem Verhältnis von „Pastoral mit Breitenwirkung“ und „Pastoral der Dichte bzw. Intensität“ sehe ich eine der großen Herausforderungen auch und gerade im Pfarramt. Hier liegt auch eine der großen und noch nicht befriedigend gelösten Herausforderungen für den Gemeindeaufbau. Das Problem besteht darin, daß sich die Erwartungen und Vorgaben für den Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer an der „Pastoral mit Breitenwirkung“, konkret: am volkskirchlichen Betreuungsmodell orientieren. Die Zahl der zu „versorgenden“ Gemeindeglieder, Gottesdienste, Kasualien und Besuche, Unterricht und Verwaltung – das sind die verpflichtend vorgegebenen Aufgaben. Wesentliche Elemente einer „Pastoral der Dichte und Intensität“ hingegen werden von vielen als Kür betrachtet. Übergeht man diesen Bereich, sind über die Unzufriedenheit einiger Gemeindeglieder hinaus kaum Konsequenzen zu befürchten. Hier müsste auf vielen Ebenen weitergedacht und -gearbeitet werden, damit „Gemeindeaufbau“ im Sinne der „Pastoral der Dichte bzw. Intensität“ nicht nur dort stattfindet, wo es Pfarrerinnen und Pfarrern von ihrer Veranlagung und Begabung her gelingt, beide Aufgabenbereiche in ihrer Person miteinander zu verbinden und zu integrieren.
6. „Verheißungsorientierte Gemeindeentwicklung“
Glaube entsteht nach dem Augsburger Bekenntnis wo und wann Gott will (CA V). Das kann man unterschiedlich auslegen – ich meine jetzt nicht auf der theologischen, sondern auf einer mentalen Ebene. Man kann das so verstehen: Wo und wann Gott will – wir haben das nicht in der Hand. Wir können keinen Glauben machen. Und das kann dann schnell resignative Züge annehmen, vor allem dann, wenn er sich mit scheinbar erfolglosen Bemühungen verbindet: Gottesdienste, Konfirmandenunterricht, Hausbesuche, Religionsunterricht – was ist geblieben?
Man kann die Stelle auch anders akzentuieren: Gott will, daß Glaube geweckt und gestärkt wird, er will daß seine Gemeinde wächst. Das sagt uns die Heilige Schrift immer wieder. Sicher, wir können Glauben und Wachstum nicht machen – das hat Gott sich vorbehalten. Aber wie wirkt Gott? Durch Instrumente, Werkzeuge. Gott will unser Handeln in seinen Dienst nehmen. Unsere Bemühungen um Inkulturation des Evangeliums, unsere Bemühungen darum, für andere einen Weg hin zum Glauben in elementaren Schritten zu gestalten, unsere Bemühungen um die Gestaltung der Gemeinde und den Gemeindeaufbau, unsere Bemühungen darum, ein Umfeld zu schaffen und zu gestalten, in dem Glaube wachsen kann.
Auch die Glaubensvermittlung, auch der missionarische Auftrag bedarf einer verantwortlichen und planvollen Wahrnehmung und Gestaltung – im Vertrauen darauf, daß Gottes Geist durch unsere menschlichen Bemühungen und durch unsere begrenzten Möglichkeiten tamquam per instrumenta (CA V) (wie als mit Instrumenten oder Werkzeugen) sein Werk tut. Deshalb steht all unser Tun, das auf Glauben zielt, unter seiner Verheißung. Gott will, daß Glaube geweckt wird, daß Gemeinde wächst, er will, daß Menschen in unseren Gemeinden zu fröhlichen Christenmenschen werden. Er hat verheißen, daß sein Wort nicht leer zurückkommt.
„Wachsende Kirche“ geht nicht von einer „wir-können-sowieso-nichts-tun“-Mentalität aus, sondern von Gottes Verheißung. Angesagt ist „verheißungsorientierte Gemeindeentwicklung“ (Burghard Krause). Gottes Verheißung führt nicht zur Untätigkeit, vielmehr zielt sie auf unseren Glauben und unseren Gehorsam. Sie „pro-voziert“ Glaube und Gehorsam, ruft sie hervor. Unseren Gehorsam, der in einer liebevollen und phantasievollen Gemeindearbeit sich auswirkt – zur Ehre Gottes und zum Wachstum seiner Gemeinde.
Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung – Theologische Fakultät Greifswald
Veröffentlichung mit Genehmigung des Autors
Aus: Rundbrief 40 (März 2008) der Ev. Sammlung in Württemberg
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Dienstag 1. April 2008 um 9:56 und abgelegt unter Gemeinde, Kirche, Theologie.