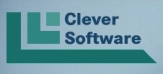Beihilfe zur Selbsttötung? – Eine ethische und seelsorgerliche Beurteilung
Freitag 14. September 2012 von Prof. Dr. Ulrich Eibach

Beihilfe zur Selbsttötung? – Eine ethische und seelsorgerliche Beurteilung1
I. Zum geistig-kulturellen Hintergrund der Diskussion
Seit einigen Jahren wird im Medizin- und Betreuungsrecht immer mehr die Selbstbestimmung der kranken Menschen betont. Hintergrund sind die Fortschritte der Medizin, die es zweifelhaft werden lassen, ob all das, was die Medizin machen kann, wirklich den Wünschen der Menschen entspricht. Am bedeutsamsten dürfte je doch die Individualisierung und Säkularisierung der Lebens- und Wertvorstellungen sein. Im Zuge dieses Wertewandels wurde die Autonomie zum vorherrschenden moralischen und rechtlichen Leitbegriff. Beides gemeinsam führte zur Krise des bis dahin in den Heil- und Pflegeberufen leitenden Ethos der Fürsorge. Es gerät so unter den Verdacht eines „paternalistischen“ Behandelns als Objekt mehr oder weniger wohlmeinender Fürsorge. Nicht mehr das Wohlergehen der Patienten und der Schutz ihres Lebens, sondern allein ihr Wille soll oberste Leitlinie ärztlichen und pflegerischen Handelns und auch der Betreuung sein2.
Die Rechtsprechung ist dieser Entwicklung gefolgt, und der Gesetzgeber hat 2009 ein „Patientenverfügungsgesetz“ erlassen, nach dem ausschließlich der Wille der Patienten zum Maßstab ärztlichen und pflegerischen Handelns erhoben wird. Das soll dem Schutz des Menschen vor ungewollter Fremdverfügung dienen. Die „Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung“3 sind dieser Entwicklung gefolgt. Wurde in den Fassungen von 1998 und 2004 noch betont, dass die Beihilfe zum Suizid dem „ärztlichen Ethos widerspricht“, so wird in der Fassung von 2011 nur noch gesagt, dass sie „keine ärztliche Aufgabe“ ist. Als „Privatperson“ könnte ein Arzt demnach Beihilfe zum Suizid leisten. Gegen diese Formulierung gab es allerdings in der Ärzteschaft erheblichen Widerstand, so dass der Ärztetag 2011 mit deutlicher Mehrheit beschloss, in die für ärztliches Handeln verbindliche Berufsordnung die Formulierung aufzunehmen, dass es Ärzten verboten ist, „Patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.“ Dies entspricht den ethischen Positionen, die auch die EKD4 und die „Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa“5 dazu einnehmen. Die Frage bleibt allerdings, wie lange sich die Ärzteschaft der zunehmenden Billigung der Beihilfe zur Selbsttötung in der Gesellschaft verschließen wird.
Diesem Wertewandel entspricht, dass die Autonomie, im Sinne einer uneingeschränkten Selbstbestimmung, immer mehr als grundlegender oder gar alleiniger Inhalt der Menschenwürde nach Artikel 1 des Grundgesetzes (GG) angesehen wird. Daraus wird abgeleitet, dass der Mensch nicht nur ein Recht hat, sich gegen die Eingriffe anderer in sein Leben zu wehren, sondern auch ein uneingeschränktes Verfügungsrecht über sein Leben und daher auch ein Recht, den Zeitpunkt seines Todes selbst zu bestimmen. Daher ist nicht mehr der Schutz des Lebens, sondern ist der Schutz der Autonomie oberstes verfassungsrechtliches Gebot, dem der Schutz des Lebens eindeutig untergeordnet sei. Der Staatsrechtler M. Herdegen6 hat in seinem neuen Kommentar zu Artikel 1 des GG daraus die Folgerung gezogen, dass sich aus der Autonomie ein positives Recht auf Selbsttötung ergebe. Folgerichtig müsste sich daraus auch ein Recht auf Beihilfe zur Selbsttötung oder gar auch ein Recht auf Tötung auf Verlangen ergeben, sofern der, der sie leistet, dies aus freien Stücken tut.
II. Fallbeispiele: Entfaltung der Problematik
Bei meinen Überlegungen gehe ich davon aus, dass kein grundsätzlicher Unterschied zwischen einer Beihilfe zur Selbsttötung und einer Tötung auf Verlangen besteht.7 Dieser Unterschied ergibt sich primär aufgrund juristischer Konstruktionen. In Deutschland ist, weil der Suizid straffrei ist, auch die Beihilfe zur Selbsttötung straffrei, sofern die „Tatherrschaft“, also die Letzthandlung, die in einer Kette von zum Tode führenden Handlungen den Tod letztendlich verursacht, beim Suizidanten liegt. Dagegen lassen sich viele Einwände geltend machen. Warum sollte z.B. einem Menschen, der die Beihilfe zur Selbsttötung als Wunsch in einer Patientenverfügung niedergelegt hat, er dann aber plötzlich in einen Zustand gerät, in dem er die Tatherrschaft nicht mehr selbst ausüben kann, die Tötung durch andere verweigert werden? Entscheidend ist doch, dass ich dem Wunsch eines Menschen, seinem Leben ein Ende zu setzen, zustimme und ihm aktiv die Mittel zugänglich mache, durch die der Tod verursacht wird. Ob ich sie ihm dann auch noch verabreiche, macht ethisch gesehen keinen entscheidenden Unterschied aus.
1. Beispiel: Frau K. liegt mit fortgeschrittenem Krebs auf einer onkologischen Station.
Bei den Besuchen klagt sie über unerträgliche Schmerzen. Der behandelnde Oberarzt sagt, sie sei schmerzmäßig gut eingestellt. Wiederholt äußert sie, sie möchte tot sein. Nachdem eine vertrauensvolle Beziehung entstanden ist, sagt sie eines Abends: „Herr Pfarrer, ich kann und will nicht mehr. Es soll da eine Organisation geben, die einem hilft zu sterben. Da kann man Mittel bekommen. Können Sie mir die besorgen!?“ Ich schweige. Daraufhin sagt sie: „Können Sie mir denn wenigstens die Adresse besorgen?!“ Nach einer Weile sage ich: „Frau K., was ist denn das Schlimmste, das sind doch nicht nur die Schmerzen?!“ Sie beginnt laut zu weinen. Als sie sich beruhigt hat, sagt sie: „Herr Pfarrer, ich habe Kinder, die wohnen alle in der Umgebung, aber in dieser Woche (es ist Freitag) hat mich nur eins besucht.“ Ich sage: „Das ist das Schlimmste?!“ Sie nickt. Wir sprechen über diese Enttäuschung, über ihre Angst vor dem Tod, die insbesondere abends ihre Seele massiv erfasst, und über die dadurch gesteigerten Schmerzen. Beim Abschied sagt sie: „Jetzt sind meine Schmerzen fast weg.“ Nach diesem Abend hat Frau K. die Thematik „Tötung“ nicht mehr erwähnt und ihre Schmerzen immer als „erträglich“ bezeichnet.
Die wesentlichen Fragen, die sich aus diesem Beispiel ergeben, sind folgende: Unter welchen Umständen wird ein Wunsch nach Erlösung vom Leiden durch den Tod zum Tötungswunsch, und wie kann ich ermitteln, welche Motive wirklich hinter einem Tötungswunsch stehen? Todeswünsche, bis hin zu Tötungswünschen, sind bei der Mehrzahl der Menschen Durchgangsstadien im Prozess der tödlichen Krankheit. Bei einigen verfestigen sie sich zu wiederholt ausgesprochenen Suizid- oder Tötungswünschen. Die Gründe für solche Tötungswünsche sind vielfältig und den Menschen oft auf der Bewusstseinsebene nicht klar. Es sind nicht nur physische Schmerzen und Ängste vor Schmerzen und dem Sterben, sondern auch Ängste vor der Vernichtung im Tod, auch Enttäuschungen über das eigene Leben und andere Menschen und Konflikte mit Menschen, es sind also häufig seelische Probleme, die nicht mehr aushaltbar erscheinen. Die Frage, inwiefern es sich hier nicht nur im juristischen Sinne um „freie“ Willensentscheidungen handelt, drängt sich notwendig auf. Von Selbstbestimmung kann man eigentlich nur sprechen, wenn der Mensch seine Ängste vor dem Sterben und Tod durchgearbeitet hat und den Tod annehmen kann. Dann schwindet aber allermeist auch der Tötungswunsch, ja oft auch der überwertige Todeswunsch. Der Mensch kann sich in sein Geschick ergeben, ohne nur von Angst und Depression bestimmt zu sein. Jedem wird einleuchten, dass Frau K. in diesem Sinne eher unfrei als frei war.
2. Beispiel: Ein über 80-zigjähriger General a.D. ist mit einem metastasierten Prostata-Karzinom aus einem anderen Krankenhaus in die Klinik eingewiesen worden. Bald nach Beginn des Gesprächs sagt er:„Herr Pfarrer, machen Sie sich keine Mühe, ehe es so weit ist, werde ich ‚in Ehren abtreten‘!“. Ich sage: “Sie wollen nicht auf die Hilfe anderer angewiesen sein!?“ Er: „Genau, das sehen Sie richtig. Man darf nicht von anderen abhängig werden!“ Nach einer Weile greife ich zu einer konfrontativen Intervention und sage: „Und Ihre Frau, wenn die einen Brustkrebs hat, der so ähnlich metastasiert, die soll auch in Ehren abtreten, bevor sie auf Ihre Hilfe angewiesen ist!?“ Der General ist sichtlich verunsichert, ringt mit sich und antwortet dann nach einer längeren Pause: „Ich würde sie schon gerne pflegen!“
Die Antwort macht die Widersprüchlichkeit des Ideals vom selbstbestimmten Tod hinreichend deutlich. Es ergab sich ein offenes Gespräch zwischen dem Patienten und mir. Ich versuchte ihm zu vermitteln, dass die Angst vor Hilfebedürftigkeit zwar berechtigt ist, dass der Ausweg einer „Selbsttötung“ aber nicht Ausdruck von Freiheit, sondern von Angst und mithin – psychologisch gesehen – von Unfreiheit ist, dass er erst frei sei, wenn er von dieser Angst befreit sei. Ferner verdeutlichte ich ihm, dass das Angewiesensein auf andere Menschen das Leben nicht entwürdigen kann, zumal er ja selbst seine Frau gerne pflegen wolle. Deshalb könne auch sein Angewiesensein auf die Liebe und Fürsorge seiner Frau und anderer sein Leben nicht entwürdigen, sondern lasse seine Würde durch die liebevolle Pflege geradezu aufscheinen. Wahre Freiheit bewähre sich gerade darin, dass der Mensch von der Angst, seine Würde zu verlieren, befreit wird dazu, sein Leben in die Hand Gottes und anderer Menschen loszulassen, sich der liebenden Fürsorge Gottes und von Menschen anzuvertrauen, wenn er, sich nicht mehr nur an sich selbst und seine Möglichkeiten klammern müsse Die Herausforderung des Sterbens könne für ihn gerade darin bestehen, diese Liebe anzunehmen, die Autonomie ihr unterzuordnen und so die Angst vor dem Verlust der Würde zu überwinden. Zwei Wochen nach der Entlassung teilte er telefonisch mit, dass er sich vom Gedanken, „rechtzeitig in Ehren abzutreten“, „verabschiedet“ habe.
Die Angst vor Hilfsbedürftigkeit ist eine der häufigen Hintergründe von Selbsttötungsabsichten bei somatisch schwer kranken Menschen. Sie ist insbesondere bei Menschen anzutreffen, die sehr selbstbestimmt gelebt, sich immer als „Herren“ ihres Lebens gewähnt und sich nie auf andere wirklich angewiesen empfunden haben. Das ist vor allem bei Männern der Fall. Aber „entwürdigt“ das Angewiesensein auf andere den Menschen? Liegt dem nicht eine Fiktion von Autonomie zugrunde? Neben dem Verlust der Autonomie kann aber auch die Sorge, Angehörigen zu einer schweren Last zu werden, ein Grund für Tötungswünsche sein. Hätte der Mann sich selbst getötet, so wäre das vielleicht eine selbstbestimmte, aber immer noch primär eine von Ängsten bestimmte Tat gewesen. Und wäre diese Tat verantwortbar, genauer: vor wem verantwortbar? Vor seinen persönlichen Lebensanschauungen „ja“, aber nicht vor der Familie, nicht im Horizont seiner mitmenschlichen Beziehungen. Das hat er selbst eingesehen, das wollte er daraufhin seiner Frau und den Kindern nicht antun.
3. Beispiel: Nach einem Vortrag spricht mich eine Krankenschwester an, die in Deutschland ein Pflegeheim leitet. Sie berichtet, dass ihr Vater vor einem Jahr in Holland durch „Tötung auf Verlangen“ gestorben sei. Er sei krebskrank gewesen, hätte in der letzten Zeit stark abgenommen, aber keine schweren Schmerzen, wohl aber Angst gehabt, die verbleibende Lebenszeit könne „unwürdig“ werden. Er bat den Hausarzt um „Sterbehilfe“. Dieser habe der Bitte entsprochen. Die Familie – auch sie – versammelte sich am Krankenbett. Der Hausarzt gab dem Vater ein Zäpfchen, das ihn langsam bewusstlos werden ließ. Nach sieben Stunden kam er wieder und setzte eine tödliche Spritze. Die Frau sagte, dass sie den Schritt bis heute nicht billigen könne. „Aber ich hatte doch nicht das Recht, meinen Vater davon abzuhalten, es ist doch sein Leben und seine Entscheidung gewesen!“ Auf die Frage, warum der Hausarzt dieses Verfahren gewählt habe, sagte sie: „Damit die Familie Abschied nehmen und den Vater im Sterben begleiten konnte.“ Meine Rückfrage, ob es auch den Grund hatte, dass der Schein eines natürlichen Sterbens gewahrt wurde, bejahte sie. Im weiteren Gespräch stellte sich heraus, dass sie die Frage bewegte, ob nicht viele der Bewohner des Heims, das sie leitet, in einem „unwürdigeren“ Zustand sind, als ihr Vater es war, ob sie noch leben wollten, wenn man ihnen die Möglichkeit „aktiver Sterbehilfe“ eröffnete. Auf meine Frage hin, wann denn das Leben „unwürdiges Leben“ sei, sagte sie, dass das in Holland jeder für sich entscheiden müsse. Ich wies darauf hin, dass der Schritt zur gesetzlichen Billigung der aktiven Lebensbeendigung in Holland durch eine intensive gesellschaftliche Diskussion vorbereitet wurde, dass die Bevölkerung diese Lösung allmählich für einen wünschenswerten Weg erachtet hat, Ärzte dieses Vorgehen bejahten und praktizierten und dass aktive Euthanasie dann schließlich durch das Gesetz erlaubt wurde. Deshalb sei es fast selbstverständlich, dass sich schwerkranke Menschen in ihrem Krankheitsprozess irgendwann sehr bewusst mit dieser Möglichkeit auseinandersetzen und sich fragen: Warum nicht einem möglicherweise „unwürdigen“ Leben durch eine Tötung zuvorkommen? Irgendwann werde die Beschäftigung mit dieser Möglichkeit – wie bei Suizidanten – dann zum Entschluss und – da dieser ja von allen Beteiligten als ein „freier“ Entschluss des Kranken respektiert werden solle – auch zur Tat. Auf die Frage, was wäre, wenn dieser Weg nicht rechtlich eröffnet worden wäre, ihr Vater rechtlich nicht die Wahl zwischen einer palliativ-medizinischen Versorgung bis zum „natürlichen“ Tod und der aktiven Euthanasie gehabt hätte, antwortete die Frau: „Denn hätte mein Vater irgendwie sein Leben anders beendet. Vielleicht wäre es überhaupt nicht so schlimm geworden, wie er dachte. Bei uns im Heim müssen die Menschen ja auch damit klar kommen!“
Das Gespräch macht auf einige, auch für die Beihilfe zum Suizid wichtige Aspekte aufmerksam. (1) Der Mensch soll die Freiheit haben, über sein Leben ein Letzturteil, gleichsam ein „Lebensunwerturteil“ zu fällen. (2) Dieses Urteil ist angeblich von anderen zu respektieren, weil es sich nur um sein eigenes Leben handelt. (3) Es soll der entscheidende rechtfertigende Grund für die Hilfen zum Tode durch andere sein.
Es gibt neben der Perspektive des Vaters aber auch noch die der Tochter, die dessen Schritt nicht billigen konnte und die erst nach dem Geschehen die ganze Tragweite der auch ihr zugemuteten Suizidhandlung begriff und die daran leidet, diesen Schritt nicht mit ihrem Berufsethos vereinbaren kann und die in ihrem Altenheim sich immer vor die Frage gestellt sieht: „Warum erhalten wir das Leben dieser Menschen, die zu einem erheblichen Teil ein unwürdigeres Leben als mein Vater führen?“ Diese Perspektive macht zumindest darauf aufmerksam, dass der alleinige Blick auf den Willen des Patienten eine verkürzte individualistische Sicht darstellt, der ein individualistisches, allein an der Autonomie orientiertes Menschenbild zugrunde liegt. Dabei wird oft übersehen, dass Leben immer in mitmenschliche Beziehungen eingebettet ist, die auch ein todkranker Mensch nicht aus dem Auge verlieren sollte, dass er auch in schwerer Krankheit noch Verantwortung für und vor seinen Angehörigen trägt. In meiner über 30-jährigen Tätigkeit als Klinikseelsorger habe ich viel mit Suizidanten zu tun. Anfangs hatte ich nur deren Geschick im Blick, bis ich dann im Laufe der Zeit in den Begegnungen mit Angehörigen erkennen musste, welches Leid sie zu ertragen haben. Der Suizid ist eben kein natürlicher Tod, und das seelische Leid, das er bei Angehörigen hinterlässt, ist entsprechend auch viel größer.
Auch die berufsethische Perspektive muss berücksichtigt werden. Seit der Euthanasie des Vaters ist die Krankenschwester in ihrem Berufsethos sehr verunsichert. Kann der Wunsch eines Menschen, getötet zu werden, für einen Berufsstand, der sich ethisch zur Heilung und Linderung von Krankheiten und zur Pflege von Menschen verpflichtet hat, ein hinreichender Grund sein, ihm bei dieser Selbsttötung zu helfen? Und kann Derartiges, wenn es rechtlich gebilligt und auch durch das Berufsrecht geduldet wird (wie etwa der Schwangerschaftsabbruch), den Heil- und Pflegeberufen zugemutet werden, so dass sie auch Helfer zum Tode werden dürfen?
III. Autonomie: Recht auf Selbsttötung?
Die ethische Bewertung der Beihilfe zum Suizid hängt maßgeblich von der Bewertung des Suizids ab. Dass der Mensch seinem Leben selbst ein Ende setzen kann, ist unbestreitbar. Umstritten ist, ob er ein Recht dazu hat. In der christlichen Tradition wird ein Recht auf Selbsttötung einhellig bestritten, hauptsächlich mit dem Argument, dass der Mensch sich das Leben nicht selbst gegeben hat, dass er es von Gott empfangen hat, es deshalb aber noch nicht zum Besitz des Menschen wird, über den er nach Belieben verfügen darf. D. Bonhoeffer8 und der Philosoph K. Löwith9 haben zu Recht betont, dass eine Ablehnung eines Rechts auf Selbsttötung letztlich nur „religiös“ dadurch begründbar ist, dass der Mensch nicht sein eigener „Schöpfer“ und „Gott“ ist, dass „es über dem Menschen einen Gott“ und Schöpfer seines Lebens gibt. Diese religiös begründete Ablehnung bestimmte auch noch Philosophen wie I. Kant10 und ihm folgend bis in die Gegenwart auch die Rechtsprechung und das ihr entsprechende ärztliche Handeln. Wenn allerdings das Leben seine Rückbindung an Gott oder – nach Kant – an das Sittengesetz verliert, dann ist der Mensch nur noch auf sich selbst bezogen, dann ist er autonom, im Sinne von Herr und Besitzer seines Lebens“. Er verdankt sein Leben angeblich nur sich selbst und ist daher nur sich selbst verantwortlich. F. Nietzsche11 zog aus seiner Rede vom Tode Gottes und der Behauptung, dass der Mensch deshalb sein eigener Gott sein müsse, die Folgerung, dass man die „dumme physiologische Tatsache“ des naturbedingten Todes zur Tat der Freiheit werden lassen solle: „Ich lobe mir den freien Tod, der kommt, weil ich will“, und nicht, weil die „Natur“ oder „ein Gott“ es will. Ähnlich hat es der amerikanische Ethiker J. Flechter12 ausgedrückt: „Die Kontrolle des Sterbens (sic. selbstbestimmte Todeszeitpunkt) ist wie die Geburtenkontrolle eine Angelegenheit menschlicher Würde. Ohne sie wird der Mensch zur Majonette der Natur“, und das sei des Menschen unwürdig.
Diejenigen, die den Inhalt der Menschenwürde primär in einer empirischen Autonomie gegeben sehen und aus ihr ein verfassungsrechtlich legitimiertes Recht auf Selbsttötung ableiten, werden nicht müde zu betonen, dass ein weltanschaulich neutraler Staat die Interpretation des GG nicht von religiösen Vorgaben abhängig machen dürfe, die von vielen Bürgern nicht geteilt werden, dass die Verfassung vielmehr rechtspositivistisch im Horizont der jeweils herrschenden und angeblich rein rational begründbaren Lebensanschauungen zu interpretieren sei.13 Ist das Verbot der Selbsttötung und der Tötung auf Verlangen nicht eines der letzten religiös begründeten Tabus, die die Freiheit des Menschen einschränken und von dem sich der postmoderne Mensch endgültig befreien sollte? Die Forderung nach einem Recht auf Selbsttötung ist dann ein deutlicher Ausdruck dessen, dass der säkulare Mensch sein eigener Gott sein will und muss.
Fast alle Befürworter eines Rechts auf Selbsttötung rechtfertigen dieses damit, dass Umstände eintreten können, aufgrund deren das eigene Leben nicht mehr zumutbar und nicht mehr wert ist, gelebt zu werden, also mit einem Lebensunwerturteil. Wenn der primäre Inhalt der Menschenwürde in einer empirischen Autonomie gesehen wird, dann ist es selbstverständlich, dass dem Menschen Lebenswerturteile über sein eigenes Leben zugestanden werden, in denen er sein Leben als „menschenunwürdig“ einstufen darf. Gerade ein solches Urteil stellt eine geistige Totalverfügung, ein „Letzturteil“ des Menschen über sein eigenes Leben dar. Wenn sich dieses Recht aus der Autonomie ergibt, dann schließt es auch ein, dass der Mensch befugt ist, das Urteil zu vollziehen, dem Leben ein Ende zu setzen. Und wenn er es nicht mehr selbst vollziehen kann, dann muss er dazu auch die Hilfe anderer in Anspruch nehmen dürfen, wenigstens sofern die Helfer diese Hilfe freiwillig gewähren.
Das eigentliche Problem eines Rechts auf Selbsttötung liegt also in der grundsätzlichen Anerkennung dessen, dass der Mensch sein Leben in einem geistigen Akt letztgültig als menschenunwürdig einzustufen das Recht haben soll. Denn wenn es nach subjektivem Ermessen „lebensunwertes Leben“ gibt, dann muss man auch anerkennen, dass es objektiv gesehen „lebensunwertes“ Leben gibt, das die Tötung rechtfertigt. Dies ist, wenn man den Inhalt des Begriffs „Menschenwürde“ im GG primär mit „Autonomie“ füllt, ein konsequenter Standpunkt, aber zugleich ein ethisch wie rechtlich problematischer Schluss, der weitgehende Folgen vor allem für den Schutz des Lebens unheilbar kranker Menschen haben kann.
IV. Ein anderes Menschenbild: Angewiesensein und Beziehung als Grunddimension des Menschseins
Das Menschenbild der Aufklärung rückt in einseitiger Weise das autonome Individuum in den Mittelpunkt, so dass des Menschen höchste Vollkommenheit letztlich darin besteht, dass er des Mitmenschen und Gottes nicht mehr bedarf, er aus sich selbst lebt. Das Angewiesensein auf andere ist dann eine unreife Form des Menschseins. Aber der Mensch begründet sich weder in seinem Dasein noch in seiner Würde durch sein Entscheiden und Handeln. Er wird ohne sein Zutun ins Dasein „geworfen“, ob er es will oder nicht. Er empfängt sein Leben von seinen Eltern, letztlich aber aus dem schöpferischen Handeln Gottes. Leben gründet daher primär im Angewiesensein auf andere. Der Mensch ist, um überhaupt leben zu können – nicht nur im Kindesalter und meist auch am Lebensende, sondern bleibend das ganze Leben hin-durch – auf Beziehungen zu anderen Menschen angewiesen. Er lebt in und aus ihnen und nicht aus sich selber, er verdankt ihnen und damit in erster Linie anderen und nicht sich selbst sein Leben. Daher ist das „Mit-Sein“ Bedingung der Möglichkeit des Selbstseins, hat seins-mäßigen Vorrang vor dem Selbstsein. Dem Angewiesensein entspricht das „Für-Sein“ der Anderen, ohne das Leben nicht sein, wenigstens aber nicht wirklich gelingen kann.14 Es ist kein Modus des Daseins, den der Mensch als „Stadium der Unmündigkeit“ hinter sich lassen kann und soll, damit der Mensch sein Leben und seine Würde aus sich selbst und durch sich selbst konstituiert. Leben gründet in der aller selbsttätigen Lebensgestaltung als Bedingung der Möglichkeit vorausgehenden liebenden und Leben und Würde schenkenden Fürsorge Gottes und anderer Menschen. Der Mensch wird in erster Linie in solchen Beziehungen der Liebe in seiner ihm von Gott geschenkten Würde geachtet. Der autonome Mensch, der selbst in schweren Krisensituationen sich nur selbst bestimmt und aus und durch sich selber leben kann, ist weitgehend ein theoretisches Konstrukt.
Wer von einem personal-relationalen Menschenbild ausgeht, das der Praxis des Lebens mit Krankheiten und Altersgebrechen besser als das „autonomistische“ Menschenbild entspricht, der wird auch in der Beurteilung des Suizids zu anderen Auffassungen kommen. Der sich autonom wähnende Mensch vergisst oft, dass er sein Leben immer primär anderen verdankt, dass er deshalb auch den anderen gegenüber Verantwortung trägt. Er sollte sich daher immer bewusst bleiben, was er anderen Menschen mit einem Suizid antut, welche seelische Last, nicht zuletzt Schuldgefühle, er ihnen auferlegt.
Bei vereinsamten alten Menschen ist die Suizidrate besonders hoch und die Erfolgsrate der Suizidversuche noch höher.15 Diese Menschen bestätigten mit ihren Suizidversuchen und Suiziden, dass Leben nur in Beziehungen gelingen kann und wie sehr der Mensch auf Hilfe anderer angewiesen ist. Immer mehr betagte Menschen haben Angst, anderen zur Last zu fallen. Seit einiger Zeit äußern alte Menschen aufgrund der öffentlichen Diskussionen über die finanziellen Probleme unseres Sozial- und Gesundheitssystems immer häufiger die Sorge, dass die Gesellschaft chronisch kranke, betagte und hilfsbedürftige Menschen in Zukunft hauptsächlich als eine kaum noch tragbare Belastung betrachten wird. Das könnte in die Auffassung umschlagen, dass der Suizid solcher Menschen gesellschaftlich wünschenswert ist, dass es auf keinen Fall zu verhindern ist, wenn Menschen sich den „Gnadentod“ geben wollen. Es könnte sich mit wachsendem sozialökonomischen Druck und daraus resultierender gesellschaftlicher Billigung des Suizids und gleichzeitiger Behauptung, es gebe ein verfassungsrechtlich garantiertes Recht auf Selbsttötung ein gesellschaftlicher Druck zum „Frühableben“ durch verborgene oder auch offene Formen der Selbsttötung und der Beihilfe zur Selbsttötung und irgendwann auch der Tötung auf und dann wohl auch ohne Verlangen ergeben. Die eindeutige Überordnung des Schutzes der Autonomie über den Schutz des Lebens vermag dagegen keinen wirksamen Schutzdamm aufzurichten.
Wenn Heilberufe daran aktiv beteiligt würden, könnte das unabsehbare Folgen für deren Berufsethos, für das Vertrauen der Menschen in diese Berufe und für den Umgang mit unheilbar kranken Menschen in der Gesellschaft haben. Dieses Argument ist auch nicht mit dem Hinweis zu widerlegen, dass die rechtliche Billigung des Schwangerschaftsabbruchs durch Ärzte ja auch nicht zu einer solchen Verunsicherung im ärztlichen Ethos geführt habe, denn hier handelt es sich um einen eng begrenzte Gruppe von Ärztinnen und Ärzten. Bei der Beihilfe zur Selbsttötung wären jedoch große Bereiche der Ärzteschaft involviert. Daher könnte durchaus eine nicht zu unterschätzende Verunsicherung des Vertrauens in die Ärzteschaft die Folge sein, insbesondere bei wachsendem sozialökonomischen Druck, der von der zunehmenden Zahl unheilbar kranker und pflegebedürftiger Menschen ausgeht.
Auch wenn der Suizid alter Menschen oft die Züge einer negativen Lebensbilanzierung trägt, die nicht selten einer realitätsgerechten Einschätzung der Lebenslage entspricht, ist und bleibt ihr Suizid doch ein Schrei nach mitmenschlicher Zuwendung und Hilfe, ja letztlich nach dem grundlegenden „Lebensmittel“, von dem und aus dem alle Menschen leben, den von der Liebe bestimmten Beziehungen. Den Menschen, die sich das Leben meinen nehmen zu müssen, geht es in der Regel nicht darum, ein Verfügungsrecht über ihr Leben auszuüben, sie wollen nicht erweisen, wie frei ihr Wille ist, sondern sie tun viel mehr kund, was ihnen fehlt, um leben zu können. Die Aufgabe der Mitmenschen ihnen gegenüber besteht nicht primär darin, festzustellen, ob und inwieweit sie in ihrem Willen frei oder mehr oder weniger krankhaft eingeschränkt sind, sondern ihnen die Mittel zum Leben anzubieten, die sie brauchen und suchen. Dazu gehört zunächst die Achtung der Würde des Menschen. Diese besteht aber nicht in erster Linie darin, dass man dem Menschen eine rationale Entscheidungs- und Handlungsautonomie zuspricht und diese dann in jeder Hinsicht meint als verbindlich akzeptieren zu müssen. Dem würde ja als Kehrseite entsprechen, dass man Menschen, die diese Autonomie verloren haben, ihre Würde auch absprechen und ihr Leben der Herrschaft anderer unterwerfen darf. Entscheidend ist in der Suizidprävention wie in der Behandlung von Suizidanten, dass Menschen „Lebensmittel“ zum Leben angeboten werden, und das ist das Angebot einer guten palliativmedizinischen und pflegerischen Betreuung und nicht zuletzt eines Lebens in mitmenschlichen Beziehungen, wie sie z.B. in Hospizen gegeben sind.
Ein Menschenbild, in dem der Mensch primär von seiner empirischen Autonomie her betrachtet wird, verfehlt den Menschen sowohl in seinen mitmenschlichen Beziehungen wie als leib-seelisches Subjekt, das in erster Linie von Gefühlen und vielen anderen inneren und äußeren Umständen bestimmt und oft hin- und hergerissen und immer nur mehr oder weniger frei ist, diese durch seine „rationalen Fähigkeiten“ zu bestimmen. Der mehr oder weniger freie Wille kann daher nicht primär den Ausschlag geben, wie ein suizidaler Mensch zu behandeln ist. Vielmehr wird die Würde des Menschen dadurch geachtet, dass man ihn als ganzheitliches Subjekt mit all seinen Gefühlen und Bedürfnissen wahrnimmt, also primär dadurch, dass man eine Beziehung zu ihm aufnimmt, in der er als „erste Person“ und nicht nur als Objekt von Behandlung im Blick ist.16 Zu dieser Kommunikation mit dem Subjekt darf es dann auch gehören, dass die mehr oder weniger eingeengte und verzerrte Sicht des Lebens des suizidgefährdeten Menschen auch geweitet und für neue Perspektiven geöffnet wird, ohne ihm damit eine Entscheidungsfähigkeit über sein Leben grundsätzlich abzusprechen. Wenn man die mitmenschlichen Beziehungen als die Grunddimension des Lebens betrachtet, dann ist das Urteil jedes Menschen über sein Leben im Horizont dieser, das Individuum übergreifenden Beziehungen zu betrachten, mithin der Mensch – auch der seelisch kranke Mensch – auch auf seine Verantwortung vor und für Mitmenschen anzusprechen.
Jeder Suizidversuch ist mit einer Einengung des Blickwinkels auf sich selbst verbunden, der zu dem Urteil des Suizidanten führt, dass sein Leben nicht mehr wert ist, gelebt zu wer-den, weil es z. B. für ihn und im Grunde auch für die anderen Menschen nur eine Last sei. Aufgabe derer, die in Beziehungen zu derart lebensmüden Menschen stehen und die zur Hilfe verpflichtet sind, ist es nicht, ein derartiges Urteil – nachdem die Entscheidungsfähigkeit des Betreffenden überprüft wurde – einfach zu übernehmen und zur Leitlinie des eigenen Handelns werden zu lassen. Vielmehr sind sie herausgefordert, diesem Urteil als Anwalt des Lebens zu begegnen, nicht primär dadurch, dass man das Urteil mit rationalen Mitteln widerlegt, sondern dadurch, dass man dem Menschen das anbietet, was ihm fehlt, um das Leben auch in schweren Krisen bestehen zu können. Mehr können Menschen nicht tun, denn wie einem Menschen – wenigstens aus christlicher Sicht – kein „Letzturteil“ und uneingeschränktes Verfügungsrecht über das eigene Leben zusteht, so steht natürlich erst recht keinem ein Letzturteil über das Leben anderer Menschen zu. Es kann also kein moralisches Recht auf Selbsttötung geben, das von anderen Menschen zu respektieren wäre oder an deren Ausführung sie sogar mitwirken dürfen oder gar sollen. Es kann aber auch keine Pflicht geben, einen Menschen dauerhaft zum Leben zu zwingen, wenn ihm nicht wirklich zum Leben geholfen wer-den kann. Der Suizid ist und bleibt eine ethisch nicht zu billigende menschliche Möglichkeit und Wirklichkeit, aber auch eine „Tragödie“, die immer zu verhindern die Grenzen menschlicher Möglichkeiten übersteigt und deren letzte Beurteilung dem Menschen entzogen bleibt,, die allein Gott zu überlassen ist. 17 Es gibt kein Recht auf Selbsttötung , das von anderen zu bejahen oder wenigstens zu respektieren ist, keine Selbsttötung, an der andere zu beteiligen sind, sondern nur eine Pflicht, die Selbsttötung möglichst zu verhindern, aber auch nur mit Mitteln, die nicht mehr schaden als helfen, also mit Mitteln, die zu einem Ja zum Leben, zu einem erträglichen und möglichst wenig fremdbestimmten Leben verhelfen. Und dazu gehört nicht zuletzt auch die seelsorgerliche Begleitung, deren Ziel darin besteht, den Menschen im Glauben an und Vertrauen auf Gott so zu bestärken, dass er dadurch die Kraft geschenkt bekommt, ein schweres Leidens- und Sterbensgeschick anzunehmen und zu tragen, so dass er einer Selbsttötung nicht bedarf.
Es muss nicht bestritten werden, dass es im Leben „tragische Grenzfälle“ gibt, in denen das Leiden durch die Mittel der Palliativmedizin – selbst eine „palliative Sedierung“ – und mitmenschliche und seelsorgerliche Zuwendung nicht erträglich gestaltet werden kann, Solche seltenen Grenzfälle können mit normativ ethischen und rechtlichen Regeln nicht mehr hinreichend oder überhaupt nicht mehr erfasst und beurteilt werden. Wenn in solchen Fällen die Beihilfe zur Selbsttötung oder gar die Tötung auf Verlangen erwogen wird, dann ist der, der sie erbringen soll, auf sein eigenes Gewissen zurückgeworfen.18 Verantwortung für das Leben und Handeln in Grenzsituationen des Lebens schließt die Möglichkeit des Schuldigwerdens und die Bereitschaft zur Schuldübernahme ein. Unsere Rechtsprechung kennt für solche „tragischen Situationen“ die „Rechtsfigur“ des „übergesetzlichen Notstands“, bei dem von Strafverfolgung und Strafe abgesehen werden kann und in denen Staatsanwälte und Richter eine Verurteilung meist erst gar nicht erwägen. Für diese tragischen Grenzfälle bedarf es also nicht eines Gesetzes, das die Beihilfe zur Selbsttötung oder gar die Tötung auf Verlangen ausdrücklich normativ ethisch und rechtlich regelt und billigt.19
Anmerkungen
1 Überarbeitete Fassung eines Vortrags auf einem Symposion der Ärztekammer und des Justizministeriums Niedersachsen .
2 U. Eibach: Autonomie, Menschenwürde und Lebensschutz in der Geriatrie und Psychiatrie, 2005, 9 ff.
3 Deutsches Ärzteblatt (DÄB) 95(1998), A-2365-67; DÄ B 101(2004), A-1297-99; DÄB 108 (2011), A-346-348
4 EKD: Wenn Menschen sterben wollen – Eine Orientierungshilfe zum Problem der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung, EKD-Texte 97, 2008
5 Community of Protestant Churches in Europe: A time to live and a time to die. An aid to orientation of the CPCE Council on death-hastening decisions and Caring for the dying, 2011, 70 ff., www.atimetolive.eu; vgl. St. Schardien (Hg.): Stellungnahmen aus der kirchlichen Diskussion in Europa zur Sterbehilfe, 2010
6 In: T. Maunz / G. Dürig (1951 ff.): Grundgesetz. Kommentar, Bd. 1, Lfg. 42, 2003
7 U. Eibach: Medizin und Menschenwürde, (1976), 5. Aufl. 1997, 183 ff.
8 Ethik, 7 .Aufl.1966, 179; vgl. Eibach:Anm.2, 65 ff.
9 Vorträge und Abhandlungen. Zur Kritik der christlichen Überlieferung, 1966, 274 ff
10 Vgl. H. Wittwer: Über Kants Verbot der Selbsttötung, in: Kant-Studien 92 (2001), 180 ff.
11 Also sprach Zarathustra. Werke in 3 Bde., hrsg. von K. Schlechta, Bd. II, 1964, 333 f.
12 The Patient’s Right to Die, in: A. B. Downing (Ed.): Euthanasia and the Right to Death. The Case of Voluntary Euthanasia, 1967, 61 ff.
13 N. Hoerster: Sterbehilfe im säkularen Staat, 1998, 13 ff., 61 ff
14 Eibach: Fußnote 2, 9 ff.
15 R. D. Hirsch u.a. (Hg.): Suizidalität im Alter. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie, Bd. 4, 2002, 59 ff.
16 D. Hell: Seelenhunger. Der fühlende Mensch und die Wissenschaften vom Leben. 2003
17 U. Eibach: Seelische Krankheit und christlicher Glaube. Theologische, humanwissenschaftliche und seelsorgerliche Aspekte, 1992, 252 ff.
18 U. Eibach: Sterbehilfe .- Tötung aus Mitleid. Euthanasie und „lebensunwertes Leben“, 1998, 207 ff.
19 Vgl. EKD, Fußnote 4; CPCE, Fußnote 5
Prof. Dr. Ulrich Eibach, Bonn
Quelle: Deutsches Pfarrerblatt 112 (2012), Heft 1, S. 15 – 19
Mit freundlicher Genehmigung des Verfassers sowie der Redaktion des Deutschen Pfarrerblattes.
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Freitag 14. September 2012 um 16:54 und abgelegt unter Lebensrecht, Medizinische Ethik.