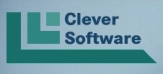Predigt über Lk. 2,41-52: Ach du Schreck – Jesus ist weg!
Samstag 27. Januar 2024 von Prädikant Thomas Karker

Liebe Gemeinde, eines der Geheimnisse der Schrift bleibt die dreißigjährige Stille, in welcher Jesus in Nazareth wohnt. In einer Biographie sind ja gerade die Jugendjahre von besonderem Interesse. Aber bei dem Herrn bleibt uns dies fast ganz verschlossen. Licht ist einst auf das kleine Kind gefallen; aus Engelsmund und Menschenlippen, von Weisen und Unweisen sind köstliche Psalmen über ihm ertönt – und nun folgt ein dreißigjähriges Dunkel, verlebt in einem entlegenen, verachteten Bergstädtchen.
Christoph Steinhofer (Dekan aus Weinsberg 1750) schrieb: „Die dreißigjährige Stille des Herrn Jesu.“ Wo die Schrift schweigt, da ist ihr Schweigen ein Reden. Aber ganz hat sie uns doch nicht ohne Nachricht gelassen über das Leben Jesu in den dreißig Jahren. Eine duftende Rose findet man doch am Wegrand aus Jesu Mund: „Muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist?“ Alles aus seiner Kindheit und Jugend ist in diesen Worten zusammengefasst. Lesen: Lk. 2,41 – 52
Diese Wort ist mehr als ein Kinderspruch. Er ist zugleich der Leitstern seines ganzen Lebens. Dies Wort ist Tat und Losung über Jesu Leben. Dieses Wort begleitet ihn durch‘s ganze Leben. Es ist eingerahmt von den Worten, die selbstverständlich zu sein scheinen: Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter“? (Lk. 2,40+52)
Warum betont Lukas das? Lukas selbst ist als Heide aufgewachsen und hat in seiner Jugend erlebt, dass man mit dem Herabsteigen der Götter auf die Erde rechnete. Der Mensch hatte zu allen Zeiten eine große Sehnsucht nach dem Göttlichen in seinem Herzen und stillte sie am liebsten durch selbstgemachte Götter.
Lukas sah, wie dem römischen Kaiser Altäre gebaut wurden, weil er sich zum Gott erklären ließ. Und die Menschen streuten Weihrauch auf seinen Altar. „Ich, Claudius, Kaiser und Gott!” Diese kaiserliche Erklärung erschien den Zeitgenossen des Lukas ganz normal. Nun stellten sich die Leute im Römischen Reich den Abstieg der Götter auf diese Erde sozusagen mit Tarnkappe vor. Sie sahen zwar aus wie Menschen, waren aber hinter dieser Fassade doch göttliche Wesen mit übermenschlichen Kräften. Ihnen fehlte die die Erdenschwere, die Gebundenheit an Raum und Zeit, die zu uns Menschen gehört.
Dieser Vorstellung seiner Zeit will Lukas ganz bewusst damit entgegentreten, dass Jesus ganz Mensch wurde und wie jedes andere Kind wachsen, älter werden und reifen musste. Er will sagen: Das Menschsein Jesu hat nicht nur „pro forma” stattgefunden. Im Gegenteil: Er hat sich all seiner Göttlichkeit „entäußert”, er und wurde ein Mensch – mit allen Nöten und Schwierigkeiten. Er hat sich seine Eltern nicht aussuchen können. Auch darin war er uns gleich. Seine Eltern kann der Mensch sich nicht aussuchen. Hier liegt einer der Schwerpunkte für die Lebenskrisen junger Menschen und leider auch mancher Christen. Sie meinen, – Gott selbst – habe ihnen nicht die richtigen Eltern zu geteilt. Sie seien in irgendeiner Hinsicht bei ihren Eltern zu kurz gekommen.
1. Sie gehen nach Zion zur Osterzeit; Auch Jesus geht mit, ist der Weg auch weit.
Ein wunderbares Wort steht am Anfang des heutigen Textes: „Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem auf das Osterfest.“ Dies beinhaltet eine Fülle von Treue. Nur dem Mann war es damals geboten, dass er zu solchen Festen nach Jerusalem ging, wo man zusammenkommen musste. In der Gemeinschaft stärkt sich die Erfahrung und aus der Erfahrung stärkt sich die Gemeinschaft. – Und Maria begleitete ihren Ehemann Joseph.
So gingen beide zusammen hinauf und erwählten unter den drei vorgeschriebenen Festen das Osterfest. Hier gedachten sie der große Gottestreue, dass Gott durch das Blut des Lammes das arme Volk vor dem Würgengel bewahrt hat.
Es ist für die Eltern ein Gang „nach Gewohnheit des Festes“, für das Kind eine „Erfüllung des Gesetzes.“ Jesus soll als ein „Sohn des Gesetzes“, dem erlaubt war im zwölften Jahre zum Tempel zu kommen, dargestellt werden. (Bar-Mizwa ab Mittelalter)
Eltern sind nach der Bibel immer Vater und Mutter, Ehe und Familie sind eine Stiftung Gottes und nur sie sind unter dem besonderen Segen und Schutz Gottes. Da kann die Regierung und die Ev. Kirche noch so sehr Ehe für alle legitimieren und propagieren.
Auf diesem Wege nach Jerusalem wurden sich die beiden bewusst, wen sie zwölf Jahre unter sich beherbergt und nicht gekannt hatten. Er kam in Sein Eigentum, und selbst die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Erinnerung an die Krippe war zu schmachvoll, der Gedanke an die Flucht zu peinvoll und all die Verfolgungen wegen dieses Kindes zu schreckensvoll.
Jesus war schon seit Jahren auf diese Reise gedanklich vorbereitet. Gewiss hatte Maria von Hanna und Samuel im Tempel, von Abrahams Opfer auf Moriah, von David in der Burg Zion erzählt, von Passah, Versöhnungstag, …, das Kind kannte die Stätten. Er hatte sich längst in sie versenkt, als ob er schon dort gewesen wäre. Und es war die Vorfreude darauf, dass er „in dem sei, was seines Vaters ist.“
Dann zog es ihn zum Tempel hin, alles andere in der Stadt war doch nicht sein Ziel „Der Vogel hat sein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, deine Altäre, Herr Zebaoth“, so stand es im Herzen Jesu. Nicht das goldene Dach, nicht die Hallen, nicht das Äußere am Tempel, sondern was in ihm war, alle die Rätsel, die er in sich schloss, zogen ihn an. Die Eltern hatten ihn hinaufgebracht, für die Eltern war der Tempel ein großes Heiligtum, das sie mit Scheu betraten; für ihn eine Heimat, in der er sich zu Hause wusste.
Nach drei Tagen finden ihn die Eltern unter den Lehrern, nicht stehend und sitzend, sondern zu ihren Füßen, zuhörend, fragend und Antwort gebend, ein wunderbares Kind und doch kein frühreifes Wunderkind. Die Lehrer „verwunderten sich seines Verstandes und seiner Antwort.“ (Urtext: sie waren außer sich) Am Fragen und Antworten lässt sich der Verstand eines Menschen erkennen, wie auch sein Unverstand.
Der alte Valerius Herberger (1562-1627) denkt sich allerlei Fragen, die das Kind gestellt haben könnte, und die den Lehrern den Boden unter den Füßen wohl heiß gemacht haben werden. „Was bedeuten die Lämmer, die am Passahmahl geschlachtet werden? Was der goldene Leuchter im Tempel und der Schaubrottisch? Was bedeutet der Vorhang vor dem Allerheiligsten? Warum geht nur der Hohepriester hinein? Warum nur einmal? Warum besprengt er sich mit dem Blute und danach den Gnadenstuhl? Warum wird der eine Bock geschlachtet und warum geht der andere frei aus? Was meint Jesaja mit dem Knecht Jehovahs, der sein Leben zum Schuldopfer gibt?“ – Jesus lernt von diesen Schriftgelehrten, was es lernen kann. Jesus sieht, wie oberflächlich ihre Antworten sind, wie wenig sie das treffen, was der Schrift eigentlicher Sinn ist. Dort zog das großes Passahopfer durch seine Seele, Opfergedanken, Opferernst und Opfertreue.
Die Schriftgelehrten mussten einen Eindruck empfangen haben, dass hier vor ihnen ein Kind steht, das so von göttlichen Dingen spricht, als wenn es sich dabei auf heimatlichen Boden befände. Jesus war hier „in dem, was seines Vaters ist.“ Aber sie mussten dazu helfen, dass ihm das Bewusstsein seiner Herkunft und seiner ewigen Bestimmung immer klarer wurde. Denn im letzten Grunde fragte doch Jesus hier nach sich selbst.
2. Sie verlieren Jesus, sie kehren um, Doch Sie finden ihn wieder im Heiligtum.
Der Vater führt ihn selbst in’s Allerheiligste, in seine unmittelbare Nähe. Hat Simeon einst in diesem Tempel Jesus auf den Armen gehalten, jetzt nimmt ihn der Vater an’s Herz und gibt ihm innerlich das Zeugnis, wie später bei der Taufe: „Du bist mein lieber Sohn.“
Und diese innere Gewissheit spricht nun das Kind in dem Augenblicke aus, als seine Eltern bestürzt und entsetzt ihn im Tempel unter den Lehrern finden und mit dem zarten Vorwurf der Liebe begrüßen: „Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Dein Vater und deine Mutter haben dich mit Schmerzen gesucht.“
Hat Maria denn alles vergessen, was der Engel ihr gesagt hatte? In heiliger Ruhe, antwortet Jesus: „Was ist’s, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem (Bereich), was meines Vaters ist?“
Luther übersetzt diese Stelle so: „Wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss!” (Lk. 2,49) „Sein“ bedeutet in der hebräischen Sprache viel mehr als das Wörtchen im Deutschen meint. Das Wort für „sein“ hat im Hebräischen zugleich die Bedeutung von „wirken“ und „leben“. „Hier gehöre ich hin für den Rest meines Lebens!“ Hier im Haus meines Vaters muss ich wirken und leben! Das müsstet Ihr doch wissen!
Jesus gibt Zeugnis von dem, was innerlich in diesen drei Tagen in ihm gereift war. Die Eltern glaubten, das Kind sei ihnen vorausgeeilt – und es war so. Es war ihnen vorausgeeilt nicht nach der irdischen, sondern nach der himmlischen Heimat, und sie haben seine Spur verloren, „denn sie verstanden das Wort nicht, das er mit ihnen redete.“ In dem Augenblick, wo der heilige Knabe die Hand seines himmlischen Vaters ergreift, lässt er die Hand der irdischen Eltern los.
Wer den Weg vom Himmel auf die Erde gefunden hat, der wird sich auch in Jerusalem zurechtfinden. Uns erscheint es aber als göttliche Fügung, dass alles so kommen musste: Dies Loslassen der Eltern, damit das Kind Jesus allein auf sich und seinen Gott gestellt, dies Meinen der Eltern, er sei unter den Gefährten, dies Verlieren und Suchen, damit sie dies Kind in seinem wahren Wesen wiederfinden würden.
Ja, Maria und Joseph waren nahe daran, dies Kind als ihr Eigentum anzuschauen. Aber mit dem „Wusstet ihr nicht“ rückt ihnen Jesus die Vergangenheit, ihr ganzes Erleben mit ihm, vor die Seele. Er selbst ist noch mehr erstaunt über die Eltern, als sie über ihn; ihm ist selbstverständlich, was ihnen unfassbar ist. Darum antwortet Jesus auf ihre Frage: „Dein Vater und deine Mutter haben dich gesucht; mein Sohn, warum hast du uns das getan?“ „Ich musste sein in dem, was meines Vaters ist“, das ist der Unterschied. Zwischen ihm und seinem Gott besteht ein unmittelbares Verhältnis des Gehorsams, ein „Muss“ ertönt. Er sagt nicht: „Ich muss sein in dem, was ‚unseres Vaters‘ ist, sondern, was meines Vaters ist“ – die Eltern stehen im Vorhof, er im Heiligtum.
Jetzt steht der „Sohn des Gesetzes“ vor ihnen als der Sohn Gottes, da zu Hause, wo sie nur Gäste sind. Darum war diese Stunde vom Vater also geleitet, sowohl für Jesus, als für seine Eltern, und Maria bekam den ersten Schwertstich, von dem Simeon ihr vorhergesagt hatte. Die drei Tage des Verlierens und Wiederfindens waren für Maria die Weissagung auf die kommenden drei anderen Tage, wo sie ihn mit Schmerzen am Kreuz verlieren, im Grab suchen und am Ostertag finden würde. Deswegen sagt der bayerische Kirchenvater Hermann Bezzel: „Die Ehe und Familie sind die Hochschule des Kreuzes.“
Sie hatten Jesus verloren und die Frage wird an uns gestellt, wie können wir Jesus verlieren?
Man verliert‘s geschwind,
An den Ecken, an den Gassen,
Wo man’s außer Acht gelassen,
Wo man sorglos ist
Um den heil’gen Christ.
Man kann Jesus verlieren auch im Tempel unter allerhand Andachten, wie Joseph und Maria bei ihrer Wallfahrt. Erst merkt man’s nicht, weil man noch vom alten Vorrat zehrt. Man tröstet sich, dass er „unter den Freunden“ sei, in der Gemeinschaft der Gläubigen, zu der man sich ja hält; bis man vergeblich ihn da und dort gesucht hat und dann merkt, wie er weg ist. Da ist dann alles nur noch Routine, man geht in den Gottesdienst, weil mans halt so macht, da hört man Jesu reden nicht mehr, man ist zwar anwesend, aber die Gedanken sind bei der Arbeit oder sonst wo. Man hat keine Zeit mehr für das Bibellesen und das Gebet und man merkt gar nicht, dass man Jesus verloren hat. Man hat sich alles so bequem in der Welt eingerichtet und ist in der Welt aufgegangen, von Jesus weitersagen, ach das bringt evt. böse Blicke, und man merkt gar nicht, wie man Jesus verloren hat.
Noch einmal wenden wir uns zu dem großen Wort: „Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist.“ „Ich muss“, dies ist eine innere Notwendigkeit. „Sein in dem, was meines Vaters ist“ – wohl war er immer in dem, was seines Vaters ist, jetzt ist die Stunde gekommen, da er mit Bewusstsein sein Lebenselement erkennt. Da ist nicht allein der Tempel gemeint; der Herr sagt nicht: „ich muss sein in meines Vaters Haus“ – sondern: „in dem, was meines Vaters ist.“ Ihm ist der Tempel nur Abbild der wahren Behausung Gottes, göttliche Taten und Verheißungen sind es, die seine Speise sein werden.
Das Muss aus Jesu Mund geht fortan durch sein ganzes Leben. Wir hören das „Muss“ der Taufe: „Es gebührt mir alle Gerechtigkeit zu erfüllen“; das Muss seines prophetischen Amtes: „Ich muss wirken die Werke Des, der mich gesandt hat“; das „Muss“ der Passion: „Ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe.“ „Soll ich den Kelch nicht trinken?“ „Des Menschen Sohn muss erhöht werden.“ „Musste nicht Christus solches leiden.“ „Des Menschen Sohn muss überantwortet werden.“ „Des Menschen Sohn muss viel leiden“ – „es muss also gehen“ – da ist nirgends ein Eigenwollen, nirgends ein bitteres Muss und Verhängnis, sondern ein heiliger Wille des Vaters, den zu tun Jesu Speise ist.
3. Sie treten den Weg nach Hause an, Jesus wächst still zum Manne heran.
Maria schweigt. Keine Gegenrede auf das Wort ihres Kindes kommt über ihre Lippen. Hat sie auch nicht alles verstanden – sie nimmt das Wort ihres Kindes als ein Samenkorn in’s Herz, es innerlich zu bewegen. Das ist wieder das Große an dieser unvergleichlichen Mutter, dass sie nun still das Kind loslässt aus ihrer Hand, das höhere Recht „seines“ Vaters anerkennt und damit in die gottgewollte Stellung zurückkehrt, nicht Eigentümerin, sondern Pflegerin und Hüterin des Kindes zu sein.
Wenn aber in Marias Seele (von Joseph schweigt fortan die Schrift) je der Gedanke erwacht wäre: „Nun wird sich mein Sohn, von mir trennen“ – so soll sie gleich erfahren, wie umfassend dies Wort: „Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist“, gemeint war. „Er ging mit ihnen hinab, und kam gen Nazareth, und war ihnen untertan.“ Er bleibt nicht im Tempel, oder in Jerusalem, sondern geht von der hoch gebauten Stadt in das verachtete Nazareth, von der Weihestunde im Tempel in das Alltagsleben einer Werkstatt. Vielleicht hätte mancher der Lehrer, geblendet von der wundersamen Begabung dieses Kindes, den Vorschlag gemacht: „Bleibe bei uns, vor dir steht eine glänzende Laufbahn; warum willst du in diesem Nazareth verkommen? solch ein Licht muss auf den Leuchter gestellt werden“ – das alles bewegt ihn nicht.
Zum ersten Gebot, „Gott über alle Dinge zu lieben“, hat er sich bekannt und lässt die Eltern los; nun bekennt er sich zum vierten: „du sollst deinen Vater und Mutter ehren“, und erfasst ihre Hand. Der himmlische Gehorsam führt ihn zum irdischen Gehorsam; auch wenn er in der Werkstatt seines Pflegevaters arbeiten musste. So ist Jesus bewusst Gehorsam um des Vaters willen. „Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? wenn er sich hält, Herr, nach deinen Worten.“ Herrlicher hat dies Wort keiner erfüllt.
Der Theologe Paul Schütz schreibt: „Das vierte Gebot ist ein Weltgrundgesetz!… Im vierten Gebot schützt Gott den letzten Rest vom Paradieseserbe… den Grundbrunnen, seine Ewigvaterschaft… Vatersname ist Gottesname… Vater und Mutter – Leben und Land, das ist im Gebot zu einem Meisterknoten verdichtet… Im vierten Gebot verteidigt Gott seine Schöpfung!… Die Weltgeschichte ist ohne die Ewigvaterschaft Gottes eine Geschichte der Selbstvernichtung.”
Wir wollen uns das Ausbildungsergebnis kurz ansehen: Woher hat er die Autorität, mit der er auftritt? Er hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt, heißt es im Hebräerbrief. Woher kommt seine Menschenkenntnis? Aus dem jahrzehntelangen Umgang mit den Leuten seiner Heimatstadt. Es heißt von ihm: „Er wusste, was im Menschen war, denn er kannte sie alle“ (Joh. 2,25). Woher hat er seine Sanftmut, d.h. den Mut, Feinden ohne Zorn oder Hass in großer Klarheit entgegenzutreten und ohne Furcht zu sagen, was gesagt werden muss? Diese Haltung braucht eine ständige Einübung. So wie keiner ein Fußballprofi wird, der nicht ständig in der Übung bleibt, so gewinnt keiner solche Sanftmut, der sie nicht eingeübt hat.
Der Ausgangspunkt ist: „Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist.“ Jemand, der sich als Gottes Kind, an diesen Vater gebunden weiß, hat sich selbst erkannt. Aber wie sollen heutzutage Kinder dies erkennen, wenn ihnen das Beste vorenthalten wird und „Religion“ die große „Nebensache“ oder nur ein „Fach“ ist, das möglichst beschränkt werden muss! „Möglichst wenig Religion und möglichst viel Bildung; möglichst wenig Zucht, und möglichst viel Selbstbestimmung – damit wächst ein Geschlecht herauf, das weder vor einer göttlichen noch menschlichen Autorität Halt macht. Natürlich möchten die Eltern, dass ihre Kinder in der Welt vorwärts kommen. Aber wenn Kinder sehen, dass sich ihre Eltern aus dem ersten Gebot nichts machen und dies: „sein zu müssen in dem, was ihres rechten Vaters ist,“ als Schwärmerei oder Borniertheit verlacht wird – wie sollen sie sich an’s vierte Gebot halten, gehorchen und dienen? Heutzutage will jeder herrschen und keiner dienen, alle befehlen und niemand gehorchen. Jesus ist immer der Diener.
Unsere Karriereleiter geht immer nach oben, Gottes Karriereleiter aber immer Stück für Stück nach unten.
Aber trotz Nazareth heißt es doch von dem Jesusknaben: „er nahm zu an Alter und Weisheit, an Gnade bei Gott und den Menschen.“ Denn alle Bildung, die das Herz nicht erfasst und nach Gottes Bild bildet, wirft den Menschen auf sich selbst zurück, macht ihn stolz, eingebildet und im Grunde perspektivlos und manipulierbar.
Das Wort des Hebräerbriefs sagt: „Er hat Gehorsam gelernt.“ Der alte Gottesmann Martin Boos (1762 – 1825 Allgäuer Erweckungsbewegung) hat darum wohl recht, wenn er sagt: „Christus ist nicht bloß in die Welt gekommen, um die Menschen zu lehren; dazu verwendete er nur drei Jahre, – sondern der Welt auch zu zeigen, wie man leben, handeln, dulden, gehorchen, sich selbst verleugnen, Gott und Menschen lieben solle. Dazu verwendete er dreißig Jahre.“
Welch ein Geheimnis! Der Sieg gehört dem Gehorsam.
Der Evangelist sagt: Er ging hinab, Schritt vor Schritt. Welch ein Gehorsam liegt in diesem Wort! Schritt um Schritt ist er nach Nazareth gegangen, bis sie ihm zum Dank über sein Kreuz schrieben: Jesus, der Nazarener. Wenn der Herr Seinem irdischen Vater nicht gehorcht hätte, so wäre er heimgekehrt und der Vater hätte Ihn nimmer gekannt.
Bleibe auf dem Wege des Gehorsams! Das ist der Segensweg!
Ich schließe. Das „Ich muss“ wandelt sich in ein heiliges „Ich will alle Tage sein in dem, was meines Vaters ist;“ und wandeln wird es sich einst in der Vollendung in den Lobgesang: „Halleluja! Ich darf ewiglich sein in dem, was meines Vaters ist! Ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar!“
Amen
Prädikant Thomas Karker, St. Markus-Gemeinde Bremen, 5.1.2020
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Samstag 27. Januar 2024 um 6:49 und abgelegt unter Predigten / Andachten.