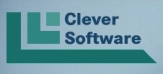Theologisches Gutachten zur „Bibel in gerechter Sprache“ – Teil II
Dienstag 13. Februar 2007 von Bischof i.R. Prof. Dr. Ulrich Wilckens (1928-2021)

Theologisches Gutachten zur „Bibel in gerechter Sprache“ – Teil II
6. Glauben als „Vertrauen“
Dieses Ergebnis im Blick auf die christologischen Titel im Neuen Testament wird dadurch bestätigt, dass in der „Bibel in gerechter Sprache“ der Glaube an Gott und an Jesus oft als „Vertrauen zu Gott und zu Jesus“ übersetzt wird.
In den Evangelien freilich ist dies nur im Matthäus und im Markusevangelium der Fall (39). Im Lukas- und durchweg auch im Johannesevangelium (40) werden sowohl das Verb „glauben“ wie auch das Substantiv „Glaube“ korrekt übersetzt (41). Besonders ärgerlich allerdings ist die Übersetzung der zentralen Verkündigung Jesu in Mk. 1,15: „Kehrt zum Leben (42) um, und vertraut dem Evangelium.“ Das Evangelium ist aber im ganzen Neuen Testament Inhalt der Verkündigung und darum des Glaubens. (43)
Vertrauen ist zwar ein Element des Glaubens, dieser ist aber vor allem durch die Autorität und Macht Gottes bestimmt, die Jesus Christus als dem einen Sohn des einen Gottes eignet. Er erweckt den Glauben an Gott, dessen Heilshandeln Er vollzieht, daher gilt ihm auch der Glaube, der zugleich Gott gegenüber gilt. Vertrauen kann man ebenso Gott wie auch Menschen – Glaube richtet sich allein an Gott und an Jesus Christus! Einen Glauben an Menschen gibt es im Neuen Testament nirgendwo und kann es nicht geben. Darum ist auch im Judentum der Glaube dem einen Gott vorbehalten; dem erwarteten Messias als einem Menschen werden die Auserwählten in der Zukunft der Endzeit zwar mit Freuden zuströmen, und unter ihm den letzten Kampf durchfechten bis zum Sieg – aber an ihn zu glauben, wie man an Gott glaubt, ist für Juden undenkbar.
Ist, was die Übersetzung als „Glauben“ oder „Vertrauen“ betrifft das Verhältnis zwischen den Evangelien in etwa ausgeglichen, so überwiegt in den Briefen des Neuen Testaments „Vertrauen“ als Übersetzungswort für „Glauben“ deutlich. Das ist ausgerechnet im Galater- und Römerbrief als den zentralen Zeugnissen der Rechtfertigungslehre des Paulus der Fall. Dessen Hauptthese in Röm. 3,28 lautet in der „gerechten“ Übersetzung so: „Nach reiflicher Überlegung (!) kommen wir zu dem Schluss (Urtext: „denn wir urteilen“), dass Menschen aufgrund von Vertrauen (Urtext: „Glauben“) gerecht gesprochen werden – ohne das schon (!) alles geschafft (!) wurde, was die Tora fordert“ (Urtext: „ohne Gesetzeswerke“). Das Gleiche erfährt der Leser bereits im voranstehenden Satz Röm. 3,27: „Welches Verständnis (!) der Tora ist gemeint? – eines, das allein auf Anstrengungen basiert (Urtext: „durch das Gesetz der Werke“)? Nein, das ist es nicht!, sondern eines (!), das auf Vertrauen gründet“ (Urtext: „durch das Glaubensgesetz“). Gemeint ist von der Übersetzerin das „Vertrauen auf Jesus“ (Vers 26). „Ihn, den Messias, hat Gott als ein durch Vertrauen wirksam und wirklich werdendes Mittel der Gegenwart Gottes, als Ort an dem Unrecht gesühnt wird, in seinem Blut öffentlich hingestellt“ (Vers 25). Das ist ein im Urtext gewiss schwer verständlicher Satz, der darum auch in der Exegese besonders umstritten ist. In dieser „gerechten Übersetzung“ aber ist er vollends unverständlich. Nach dem Voranstehenden ist nur klar, dass sich das Vertrauen deswegen auf den Messias Jesus richtet, weil Gottes Gerechtigkeit in ihm „sichtbar“ geworden ist“ (Vers 21). Diese Gerechtigkeit Gottes soll darin bestehen, das Gott den, „der es nicht schafft, das zu tun, was die Tora verlangt“ (Vers 20), gleichwohl „gerecht spricht“, wenn ein solcher Mensch einfach nur Jesus vertraut (Vers 22). Das dies irgendwie mit dem Tod Jesu zusammenhängt als einem „Ort, an dem Unrecht gesühnt wird“, ist der Erwähnung vom „Blut“ Jesu zu entnehmen (Vers 25). Nach der „gerechten Übersetzung“ aber besteht das Wichtige der Rechtfertigungslehre des Paulus darin, dass ein Mensch auf Jesus schlicht vertrauen darf und soll, wenn er es nicht schafft Gottes Gebote zu erfüllen; und da das „kein Mensch schafft“ (Vers 20) und so „alle Unrecht begangen haben“ (Vers 23) ist „jetzt“ das Vertrauen zu Jesus die einzige Möglichkeit, von Gott gerecht gesprochen zu werden, und das gilt für Juden wie für Menschen aus allen anderen Völkern (Vers 29f). So ist es denn auch das Gottvertrauen Abrahams nach Gen. 15,6, das nach Röm. 4,1ff das zentrale biblische Vorbild christlichen Vertrauens ist. Erst durch diesen Abraham-Abschnitt wird deutlich, dass mit dem Vertrauen zu Jesus von Anfang an ein völliges Vertrauen zu Gott gemeint ist, das erst jetzt vollauf möglich wird, nachdem Gott Jesus von den Toten auferweckt hat (Vers 4,24). Denn darin hat Gott seine Allmacht erwiesen (4,17), auf die bereits Abraham in unbeirrtem Vertrauen gesetzt hat (4,18ff). Unser christliches Vertrauen in Jesus also erlangt, was Gott Abraham gesagt hat: dass er diejenigen als gerecht anerkenne, die ihm vertrauen. Vertrauen zu Jesus ist in diesem Sinne nichts anderes als schlichtes Gottvertrauen.
So wird sichtbar: Durch die Wahl des Wortes „Vertrauen“ als weithin alleinige Übersetzung von „Glauben“ vollzieht sich eine sublime Gewichtsverlagerung. Aus dem Glauben an das Heilshandeln Gottes im Christusgeschehen wird ein allgemeines Gottvertrauen. Und während bei Paulus Gott den „Gottlosen gerecht macht“ (Röm. 4,5) dadurch, dass er ihm den Glauben an Jesus Christus, den für ihn Gekreuzigten und Auferstandenen, schenkt, besteht die Rechtfertigung nach der „gerechten Übersetzung“ darin, dass „Gott auch (!) die gerecht spricht, die Gott bisher (!) missachtet haben“.
Diese Differenz zeigt sich dann besonders kräftig in der Übersetzung von Röm. 5,1-5. Dort heißt es ganz im Sinne allgemeiner menschlicher Lebenserfahrung: Vertrauen sei die Kraft zur „Lebensgestaltung“ (Vers 2), zur Hoffnung und ihrer Bewährung „in den Momenten, in denen wir in großer Not sind“ (Vers 3). So aber werde die „Kraft zum Widerstand“ in uns gestärkt, durch diese wiederum die „Erfahrung, dass wir standhalten können“ (Vers 4) und durch diese schließlich die Hoffnung, die“ nicht ins Leere führt“ weil durch Gottes Geistkraft seine Liebe „in unsere Herzen gegossen ist“ (Vers 5). Offensichtlicher als hier kann es nicht sein, dass diese „Übersetzung“ den paulinischen Text nicht wiedergibt. Durch sie aber werden die Sätze im Text des Paulus, die vom Christusgeschehen als Grund unserer Rechtfertigung und vom Glauben als der alleinigen Weise, diese zu empfangen, schlicht unverständlich. „Gerecht ist, wer Vertrauen lebt“ – das ist es, was von der ganzen Rechtfertigungslehre übrig bleibt.
Der Galaterbrief stimmt in der Übersetzung leider vollauf mit der des Römerbriefs überein; ebenso überwiegend auch die Korintherbriefe. In den anderen Briefen und Schriften des Neuen Testamentes wechselt der Gebrauch von Glauben und Vertrauen in ganz unterschiedlichem Maß. Zwei besonders ärgerliche Bespiele mögen hier noch angeführt werden. In Titus 3,8 soll das Gottvertrauen zu politischem Handeln im modernen Sinn führen: „Damit die, die auf Gott vertrauen, engagiert nach Möglichkeiten suchen, für das Gemeinwohl tätig zu sein“. Im Urtext heißt es: „Damit die, die im Glauben an Gott ihren Stand haben, darauf bedacht sind, sich guter Werke zu befleißigen“. In Apg. 16,31 fordert Petrus den Hauptmann Kornelius zum Christwerden auf: „Vertraue auf Jesus den Herrn, und es wird dir geholfen werden.“ Im Urtext dagegen heißt es: „Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden.“ Rettung des Lebens in der Bekehrung zum Glauben an Jesus Christus als den Herrn und Lebenshilfe, die man durch ein Vertrauen auf Jesus gewinnen kann, sind zwei völlig verschiedene Botschaften.
Zusammenfassend ist zu sagen: Die Tendenz der „Bibel in gerechter Sprache“, den Glauben an Gott und an Jesus Christus, Gottes Sohn, auf das Moment des Vertrauens zu reduzieren, führt dazu, dass wichtige andere Momente des Glaubens nach neutestamentlichem Verständnis ungebührlich zurücktreten oder gar ausgeblendet werden. Dazu gehören: die Unterstellung unter die Heilsmacht und den Heilswillen Gottes, die im Sühnetod Christi und in seiner Auferweckung verwirklicht worden sind; die Annahme der Verkündigung dieses Heilgeschehens mit dem Ja zu einem ganzheitlichen Lebensgehorsam im Glauben sowie nicht zuletzt auch die Verbundenheit mit allen an Jesus Christus Glaubenden, die Einheit des Glaubens der ganzen Kirche. Die Übersetzungen retuschieren zwar diese anderen ‚objektiven’ Momente des Glaubens nicht immer völlig, sie lassen aber allesamt das subjektive Moment persönlichen Gottvertrauens so stark dominieren, dass sich ein Sinn ergibt und ein Ziel in die Mitte tritt, die den Glauben in seiner Ganzheit verändern. Vor allem wird so nicht mehr verstehbar, dass aller Glaube an Gott im Neuen Testament sich auf das Heilshandeln Gottes in Tod und Auferstehung Jesu Christi als Grund des Heils bezieht und sich darum alles Vertrauen des Christen zu Gott und zu Jesus darauf gründet. Das zeigt sich vor allem in der Übersetzung der Rechtfertigungspartien im Römer- und Galaterbrief, deren Aussagen daher hier und da eine Plattheit erfahren, wie sie in dieser Ärgerlichkeit in keiner anderen Übersetzung zu finden ist.
7. Das Verständnis des Geistes
Der Geist (griechisch: das Pneuma) wird in der „Bibel in gerechter Sprache“ durchweg einheitlich als „die Geistkraft“ übersetzt. Zwar steht dies im Urtext nirgendwo an den vielen Stellen, an denen vom Geist Gottes oder vom Heiligen Geist die Rede ist. Aber die ideologische Vorgabe, Gottes Geist müsse sprachlich femininen Geschlechts sein, weil „sie“, Gott, in ihrer mütterlichen „Zuwendung“ auf frauliche Art mit uns handele, gebietet offenbar so zwingend die Übersetzung „des“ Geistes“ mit „der“ Kraft, dass dieser Ausdruck „Geistkraft“ tatsächlich an sämtlichen Geiststellen des Neuen Testamentes das Übersetzungswort für das griechische Wort Pneuma sein muss. Dafür lässt sich schwerlich anführen, dass das entsprechende hebräische Wort „ruach“ weiblichen Geschlechts ist. Denn zum einen ist, sprachwissenschaftlich gesehen, das geschlechtliche System der Wortbildung in keiner Sprache Ausdruck eines inhaltlich geschlechtlichen Wortsinnes. Vor allem aber gilt andererseits inhaltlich: Im Alten Testament ist Gottes „ruach“ zwar ganz und gar schöpferisch-machtvoll; sie ist aber selbst nicht allgemein Gotteskraft (44), sondern die Kraft seines Handelns und besonders die Wirkkraft seines Wortes (vgl. Jes. 55,10f). Gottes Geist durchweg und allein als Kraft zu benennen, ist gesamtbiblisch als abstrahierende Verengung zu beurteilen. Gott selbst ist das Subjekt all seines Redens und Handelns, nicht seine Kraft. Dogmatisch ausgedrückt: Die Übersetzung der „Bibel in gerechter Sprache“ bringt ein rein dynamistisches Verständnis des Heiligen Geistes zur Wirkung und eliminiert die Elemente seines personalen Charakters.
In Apg. 13,4 werden Barnabas und Saulus im Urtext „durch den Heiligen Geist“ ausgesandt, also durch Gott selbst, nicht nur durch Gottes Kraft; und wenn Gott seine Boten zum Zeugnis mit seinem Geist ausstattet ( Apg. 1,8), so bedeutet das, dass er selbst in ihrem menschlichen Zeugnis zu Wort kommt. Jesus sagt seinen Jüngern zu, dass nicht sie, sondern der Geist ihres Vaters der ist, der in ihnen redet; nicht nur seine „Geistkraft“ (Mt. 10,20). Und wenn es in Apg. 16,6f heißt, der „Geist Jesu“ habe die beiden Missionare daran „gehindert“, die von ihnen geplante Wegroute zu gehen, dann ist es Jesus, der sie ganz konkret erfahren lässt, dass er selbst der Handelnde auf ihrem Wege ist. In der „gerechten Übersetzung“ dagegen ist hier überall von der „Geistkraft“ die Rede.
Das personale Wesen des Geistes kommt im griechischen Urtext des Neuen Testamentes besonders in den vier Ankündigungen Jesu in Joh. 14,16f.26; 15,26; 16,7ff zum Ausdruck: Als „Paraklet“ – d. h. als „Anwalt“, der die Jünger „tröstet“ – werde „der Geist der Wahrheit“ an seiner Statt (14,16) in die Mitte seiner Jünger kommen und „bei ihnen bleiben“, sie „alles lehren“, was er ihnen zuvor gesagt hat (14,26), mit ihnen zusammen das Zeugnis über ihn in die Welt tragen (15,26), die Welt „überführen“ (16,7ff) und seine Jünger „im ganzen Bereich der Wahrheit führen (16,13). Dieser „Paraklet“ ist eine Person, vom Vater gesandt wie zuvor der Sohn (14,16) und zugleich vom verherrlichten Sohn gesandt „vom Vater her“ (15,26). Die Übersetzerinnen jedoch tilgen diesen personalen Charakter, indem sie aus dem „Tröster“ einen „Trost“ machen, den „die Geistkraft“ spendet. Das stimmt damit überein, dass sie auch die Rede vom Vater und vom Sohn tilgen und sie durch „Gott“ und durch das „Ich“ Jesu ersetzen (siehe oben). Damit verschwindet lautlos ein wichtiges Element trinitarischen Gotteshandelns im Neuen Testament.
Die anthropologische Tendenz im Verständnis des Geistwirkens zeigt sich besonders ärgerlich in der Übersetzung von Römer 8, 5-11. Der hier im Urtext bestimmende Gegensatz zwischen „Fleisch“ und „Geist“ wird willkürlich so umschrieben, dass mit „Fleisch“ die „Begrenztheit“ in menschlichen Vorstellungen gemeint ist (Vers 5). Die Menschen, die sich davon „bestimmen lassen“, haben eine entsprechend „begrenzte Lebensperspektive“ (Vers 6), eine „begrenzte menschliche Denkweise“, die „Gott gegenüber feindlich“ ist und zum Tod führt, „weil sie sich nicht der Tora Gottes unterstellt und auch gar nicht in der Lage dazu ist“ (Vers 7). Solche Menschen haben „nicht die Kraft, etwas (!) für Gott zu tun“ (Vers 8). Diejenigen jedoch, „die sich an der Geistkraft orientieren (!), gewinnen Einsicht (!) in das Wirken der Geistkraft“ (Vers 5) und eine an dieser „ausgerichtete Perspektive“, die „Leben und Frieden“ bedeutet (Vers 6). „Wenn ihr aber mit Hilfe der Geistkraft den Zuständen ein Ende macht, in denen eure Körper benutzt werden, dann werdet ihr leben“ (Vers 13). Was für Zustände hier gemeint sind, bleibt das Geheimnis der Übersetzerin. Es dürfte hier nicht nötig sein, solcher freien Paraphrase des Urtextes diesen selbst gegenüberzustellen, um der Willkür einer modernen-moralisierenden Umdeutung eines der tiefsinnigsten und großartigsten Aussagen des Apostels Paulus innezuwerden.
8. „Der Jude Jesus“
Es sei zum Schluss noch auf die Auswirkung der zweiten Vorgabe dieser „Übersetzung“ des Neuen Testamentes hingewiesen, „Gerechtigkeit im Hinblick auf den christlich-jüdischen Dialog“ (Seite 10).
Nützt es wirklich diesem Dialog, wenn z. B. in der Übersetzung des Johannes-evangeliums dort, wo Jesus mit „den Juden“ Streitgespräche führt, immer betont wird, dass er dies als „der Jude Jesus“ mit „den anderen jüdischen Menschen“ getan habe? (45) Dies ist doch einerseits völlig selbstverständlich. Andererseits handelt es sich aber hierbei im Sinne des Johannesevangelisten durchweg nicht um Streitigkeiten zwischen Juden. Vielmehr tritt hier Jesus durchweg als der Sohn des Vaters „den Juden“ gegenüber. Das ist es, was im Johannesevangelium ebenso betont hervortritt, wie z. B. im Matthäusevangelium die einzigartige, göttliche Lehrautorität Jesu im Gegenüber zu der aller „Schriftgelehrten“. In der Bergpredigt tritt Jesus mit „Ich aber sage euch“ nicht Kollegen in einem Lehrhaus-Disput mit seiner eigenen Lehrmeinung gegenüber („Ich lege euch das heute so aus“: Mt.5,22.28.32.34.39.44), sondern als messianischer Lehrer mit außerordentlicher Vollmacht gegenüber der gesamten vorhergehenden Lehrtradition (7,28).
Von der Wiedergabe des griechischen „Christus-Prädikats“ durch den jüdischen Messias-Titel war bereits oben die Rede. Die ist zwar an sich völlig berechtigt, wenn dabei der wesentliche Unterschied zwischen der christlichen Verkündigung Jesu als des messianischen Sohnes Gottes und der jüdischen Erwartung des Messias als eines von Gott besonders erwählten und beauftragten Menschen aus Davids Geschlecht hinreichend beachtet wird – ein Unterschied, der nach den johanneischen Schriften der entscheidende Gegensatz zwischen Juden und Christen ist, weil für „die Juden“ der Anspruch Jesu, als der Messias der „einziggeborene“ Sohn des einzig-einen Gottes zu sein, schlimmste Blasphemie ist (46): In der „gerechten Bibel“ hingegen werden zwar alle diese jüdischen Vorwürfe wiedergegeben. Weil hier jedoch Jesus die exklusive Gottessohnschaft entzogen und durch seine – wie immer geartete – Herkunft von Gott ersetzt wird und auch aus dem „Menschensohn“ ein Mensch geworden ist, wenn auch ein von Gott in besonderer Weise „erwählter“, ist die ihm verbliebene Messiaswürde eigentlich kein Grund mehr, ihm Gotteslästerung vorzuwerfen. Nach dem Urteil der Übersetzerin von Joh. 5,17 lässt sich dieser Vorwurf in der christlichen „Textaussage“ als einigermaßen „absurd“ beurteilen (47), was der Sache nach dann auch für alle ähnlichen Stellen gelten muss. So gesehen, erübrigt sich dann allerdings der Streit zwischen Juden und Christen in neutestamentlichen Texten für den heutigen christlich-jüdischen Dialog. Bevor freilich der jüdische Partner dem zustimmen könnte, müsste er zweifellos irritiert zurückfragen, ob denn das christologische Bekenntnis zu Jesus als Gottes einziggeborenen Sohn, das zwanzig Jahrhunderte hindurch in allen Kirchen die Mitte ihres Glaubens gewesen und bis heute geblieben ist, durch solche Manipulationen wirklich als Trennungsgrund aus der Welt geschafft worden sei? Alle echten Christen stellen diese Frage auch ihrerseits an die Übersetzerin.
Der so wichtige Dialog zwischen christlichen und jüdischen Theologen heute bedarf beiderseits Partner, die die je eigene Glaubenstradition selbst vollauf vertreten. Nur so können beide die philologisch-historische Exegese des Alten wie des Neuen Testaments als Basis für die Erkenntnis vieler elementarer Gemeinsamkeiten mit Mut und Geduld benutzen. Nur: solide muss diese Basis sein, und das kann der „Bibel in gerechter Sprache“ nicht zuerkannt werden. Weder dem Urtext des Neuen Testaments wird diese „Übersetzung“ gerecht, noch auch kann sie als Basis gelten, die den Anforderungen des christlich-jüdischen Dialogs „gerecht“ wird. Für beide Partner ist die Bibel eben nicht bloß ein „Ausgangstext“ (S. 11), sondern als Heilige Schrift der Grundtext für allen Glauben und alles Leben. Seiner Auslegung lassen sich keinerlei ideologische „Kriterien“ als imperative methodische Vorgabe auferlegen, mögen diese an und für sich auch noch so diskutabel oder gar moralisch gut und für den öffentlichen Diskurs wichtig sein.
9. Gegen die Sexualisierung Gottes
Gewiss gehört das, was die Bibel uns heutigen Menschen in unserer modernen Lebenswelt zu sagen hat, zur Aufgabe ihrer Auslegung wesentlich hinzu. Nicht zuletzt wird die Ehrfurcht vor ihr, als der Heiligen Schrift durch den Reichtum von Erfahrungen vorangehender Generationen mit ihrer Bedeutung für je deren Leben bestärkt; und dies ist auch für uns heute von der Bibel zu erwarten. Die Voraussetzung dieser Erwartung war aber immer und muss es bleiben, dass es das eigene Wort der Bibel ist, das jene Bedeutung für unser Leben in sich enthält. Das Bemühen um ein richtiges Verstehen der biblischen Texte, so wie sie lauten, ist daher nicht nur der entscheidende Anfang aller Bibelauslegung, sondern die entscheidende Basis jeder Erkenntnis ihrer Bedeutung „für mich“ und „für uns“. Für die Reformation und alle aus ihr hervorgegangenen Kirchen und Gemeinschaften war und ist dies das „Prinzip“ aller Theologie; und das gilt heute auch für die beiden katholischen Kirchen, die römische und die orthodoxe. Es ist das Prinzip aller ökumenischen Theologie.
Zur Bedeutung der Bibel für unsere heutige Kirche und Welt gehören – neben vielen anderen – zweifellos auch die drei Interessen, um die es in der Übersetzung der „Bibel in gerechter Sprache“ geht. Aber dem Maß der Kräftigkeit eines solchen Gegenwartsinteresses muss ein entsprechend erhöhtes Maß von Aufmerksamkeit für den Wortlaut der Bibel entsprechen. Wenn das Interesse, modernen Frauen die Bibel zu erschließen, über das Interesse an dem Wortlaut der biblischen Texte gerecht zu werden die Oberhand gewinnt; wenn gar der Wortlaut der Bibel selbst durch die Gegenwartsinteressen bestimmt und nach Bedarf verändert wird, dann widerstreitet dies dem „Schriftprinzip“ aller christlichen Theologie. Dadurch dass solche Veränderungen bei der Übersetzung „in gerechter Sprache“ bewusst gewollt werden, verliert diese Bibel mit dem Wortlaut ihrer Texte den Charakter als Heilige Schrift. Damit exkommuniziert sie sich selbst aus der Kirche; und wenn es evangelische Landeskirchen geben sollte, die diese Bibel ihren Mitgliedern nicht nur empfehlen, sondern deren „geschlechter-gerechte“ Sprache sogar in die Sprache des Gottesdienstes einwirken lassen, müssen sie sich der Frage stellen, ob sie noch zur Kirche des Wortes gehören.
Dass Gott wie ein Vater mit seinen Kindern handelt und wie eine Mutter ihre Kinder zu bergen und zu trösten weiß, ist in der Bibel selbst hier und da zu lesen. Daraus ergibt sich aber nicht, dass Gott in seinem eigenen Wesen tatsächlich menschlichen Müttern und Vätern gleicht. Ist doch Gott selbst unendlich unterschieden von allen Menschen. Solche Vergleiche göttlichen Handelns mit menschlichem sind Metaphern, Bilder, mit denen sich Menschen Erfahrungen mit Gott plastisch-konkret verständlich machen. Sowie jedoch aus Metaphern Aussagen über Gott selbst gemacht und es gar zu einem Prinzip Gott-„gerechter“ Sprache erhoben wird, von Gott ständig als mütterlich und väterlich, als „sie“ und „er“ zugleich zu reden, ist die Grenze zwischen sinnvoll-bildlicher und sinnwidrig anthropomorpher Rede überschritten, und das heißt theologisch: Der Mensch bemächtigt sich sprachlich Gottes. Wenn bei der Übersetzung der Bibel dieser sprachliche Imperativ zu einem Imperativ inhaltlicher Rede von Gott wird, geschieht nichts geringeres, als dass nicht mehr der Mensch das Bild Gottes ist, sondern dass umgekehrt der Mensch Gott sein Bild aufprägt und alle Rede von Gott und alles theologische Verstehen nach seinem eigenen menschlichen Selbstverständnis einrichtet.
Dass Gott von uns Menschen unterschieden ist und es sein muss, wenn überhaupt wahr und wirklich ist, dass Gott uns zu retten, zu erlösen und unser Leben zu heilen vermag, das setzen natürlich auch die Übersetzerinnen voraus. Nennen doch auch sie Gott „die Lebendige“, die uns Menschen zum Leben hilft, und Christus unseren „Befreier“. Aber diesen Unterschied postulieren sie als eine Art Superlativ des Menschlichen. Können Menschen nur jeweils Frauen oder Männer sein, so ist in dieser „Übersetzung“ von Gott ständig als mütterlich und väterlich zugleich die Rede. Es wird hier geradezu zur Regel, in einem und demselben Satz von Gott abwechselnd als von „ihr“ oder von „ihm“ zu reden; und weil bislang in der traditionellen Sprache der Bibel die ausschließlich maskuline Rede von Gott herrscht, ist in der „gerechten Bibel“ in manchen Texten wie z. B. dem Magnificat gezielt-provokativ von Gott durchweg nur als von „ihr“ die Rede, oder aus dem Vaterunser in Mt. 6,9 wird : „Du, Gott, bist uns Vater und Mutter im Himmel.“ Das soll auffallen, ja aufs erste sogar stören, aber eben mit der positiven Wirkung, dass sich die Leserinnen und Leser mit der Zeit umgewöhnen – die einen aufatmend darüber, dass es endlich auch ausdrücklich ihr Gott ist, den das Zentralgebet aller Christen anruft, die anderen, der „Gerechtigkeit“ zustimmend, dass den Frauen natürlich genauso das Recht zustehen muss, von dem gemeinsamen Gott immer auch als einer Frau zu reden.
Eben darin liegt aber die tiefe Wahrheitswidrigkeit solcher willkürlichen Veränderungen des Wortlauts der Bibel. Es liegt keineswegs einfach nur daran, dass in den vergangenen Jahrhunderten, in denen die Schriften der Bibel verfasst worden sind, eben eine patriarchale Gesamtauffassung geherrscht hat, die entsprechend dem heutigen gesellschaftlichen Bewusstsein in einer „geschlechtergerechten“ Bibel zu verändern sei. Wäre die patriarchale Denkweise damals der Grund gewesen, von Gott nur maskulin zu reden, so hätte es in der gesamten Umwelt Israels, ja in allen Religionen der Alten Welt überhaupt, eigentlich all die vielen weiblichen Gottheiten nicht geben können, die damals durchaus als ebenbürtige „Partner“ ihrer männlichen Mitgottheiten gehandelt haben! Von dieser ganzen göttlichen Männer- und Frauenwelt jedoch wusste sich Israel dadurch wesenhaft unterschieden, das sein Gott Jahwe ein ICH ist, der keinerlei andere Götter neben sich duldet, weder männliche noch besonders auch weibliche. Darin drückt sich nicht etwa ein übersteigerter männlicher Alleinmachtwahn aus, sondern diese radikale Scheidung von „anderen Göttern“, die in manchen biblischen Texten sogar als nichtexistent verurteilt werden, hat ihren Grund im Wesen dieses Gottes: dass er in sich selbst ein Gott ist, der für andere „da ist“. Der Eigenname „Jahwe“ in Ex. 3,14 enthält jedenfalls unmittelbar zusammen mit dem exklusiven ICH seine wesenhafte Proexistenz. Alles, was er in sich selbst ist, ist nicht für sich selbst, sondern für Israel, sein erwähltes Volk „da“. Dieses Wesen Jahwes als Gott ist in der Tat in der gesamten Religionsgeschichte bei keinem anderen Gott zu finden.
Dieses ICH Gottes ist es, dass in der biblischen Rede mit ER aufgenommen wird. Diese Rede bemisst sich nicht an der Männlichkeit derer, die in der patriarchalen Welt Israels das Sagen hatten, sondern am Wesen dieses Gottes selbst, das sich in den Wunder- und Machttaten seiner Erwählungsliebe vom Exodus an ausdrückt. In jeder Rede von Gott als „ER“ ist das ICH seines Jahwe-Namens zu hören.
Das ist auch im Kreis der Übersetzerinnen der „gerechten Bibel“ vollauf bewusst. Ja, es muss zu deren Lob gesagt werden, dass dieser Sinn des Gottesnamens in ihrer Bibel sehr deutlich zum Ausdruck kommt, bis zur Druckgestaltung. Doch wird diese entscheidend richtige theo-logische Grunderkenntnis dadurch entscheidend verfälscht, dass hier die Einzigkeit des Gottes Israels, von der in der Tat auch im ganzen Neuen Testament die Rede ist, durch die Herausstellung seines Wesens als Mann und Frau zugleich zum Ausdruck gebracht werden. Diese Sexualisierung Gottes widerstreitet zutiefst dem Wesen dieses Gottes, der als ICH Jahwes der absolute Herr ist, wie über alle Göttinnen und Götter, so auch über alle Männer und Frauen unter den Menschen. Diese totale, grenzenlose Souveränität seiner „Proexistenz“ wird von den Übersetzerinnen bewusst gemieden – wahrscheinlich unter der Wirkung der antiautoritären Tendenz des öffentlichen Bewusstseins seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Darum muss in dieser Übersetzung nicht nur Gott zugleich weiblich und männlich, sondern er darf auch nicht mehr Herr und so auch nicht mehr Vater sein. Hier wirkt ein Wille, das gesamte Verständnis Gottes nach dem dominierenden Selbstinteresse „moderner“ Menschen zu verändern – ein Wille, der zutiefst häretisch ist.
10. Das Schlussurteil muss lauten:
Die „Bibel in gerechter Sprache“ ist nicht nur für den Gebrauch in der Praxis der Kirche nicht zu empfehlen, weder für den Gottesdienst, noch auch für den kirchlichen Unterricht und nicht einmal für die persönliche Lektüre. Sie ist vielmehr für jeglichen Gebrauch in der Kirche abzulehnen. Denn diese „Übersetzung“ unterwirft den Text der Bibel – jedenfalls des Neuen Testaments – sachfremden Interessen ideologischer Art und verfälscht so in entscheidenden Grundaspekten ihren Sinn. Weil aber die Bibel als Heilige Schrift die Wurzel und der Grund alles Glaubens und Lebens der Kirche und aller Christen ist, und weil deshalb das Bekenntnis der Kirche seine Wahrheit in der Wahrheit der Heiligen Schrift hat, darum ist die „Bibel in gerechter Sprache“ als bekenntniswidrig zu beurteilen und aus jeglichem Gebrauch in der Praxis des Lebens in der Kirche auszuscheiden.
Anmerkungen
39 Ausnahmsweise findet sich das Wort „Glauben“ in Mt. 8,13; 24,23, sowie in Mk. 13,21.
40 Das ist angesichts des sehr zahlreichen Vorkommens besonders beachtenswert.
41 Einzige Ausnahmen: Lk. 1,20; 8,50; 24,25.
42 Im Urtext gilt die Umkehr natürlich Gott!
43 Nach Röm. 10,16 ist dem Evangelium zu gehorchen; vgl. auch Röm. 15,18f; 2. Kor. 9,13; 10,5f; 2. Thess. 1,8. In 1. Kor. 15,1 nimmt man das Evangelium im Glauben an Jesus Christus an und hat darin seinen „Stand“!
44 Vereinzelt ist in Jes. 11,2 vom Geist Jahwes unter anderem auch als von einem „Geist der Stärke“ („geburah“) die Rede. Auch Sach. 4,6 kann man hier hinzunehmen.
45 Vgl. Joh. 5,15-17; 8,31 sowie durchweg die Übersetzung der Rede von „den Juden“ im Urtext als „den anderen jüdischen Menschen“: 1,19; 3,25; 5,10; 6,41.52; 7,11.35; 8,48.52.57; 9,18; 10,19.24.31; 11,31.33.36; 12,11; 13,33; 18,14.
46 Vgl. Joh. 5,18.23; 10,30–33; 19,7; 1. Joh. 2,22f; 4,2f; 5,10-12.20; 2. Joh. 7-9. Dieser Blasphemie-Vorwurf findet sich schon in Mk. 14,64; Mt. 26,65; Lk. 22,70f.
47 So in der Anmerkung 682 (Seite 2317): „Absurd“ zumal, weil in Weish. 2,16 „der gerechte Mensch Gott seinen Vater“ nenne und überdies auch „zahlreiche spätantike jüdischen Menschen über Gott als Vater redeten“ (kursiv von mir).
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Dienstag 13. Februar 2007 um 12:35 und abgelegt unter Theologie.