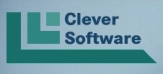Katholische Kirche und Schwangerschaftskonfliktberatung
Mittwoch 9. September 2009 von Prof. Dr. Manfred Spieker

Katholische Kirche
und Schwangerschaftskonfliktberatung in Deutschland
Die katholische Kirche in Deutschland hat die 1970 einsetzenden Diskussionen um die Reformen des Abtreibungsstrafrechts von Anfang an kritisch begleitet. Sowohl die Deutsche Bischofskonferenz als auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken wurden bis zur Reform des § 218 1992 nicht mĂŒde, das Lebensrecht ungeborener Kinder gegen die ReformplĂ€ne der Legislative zu verteidigen und vor den zerstörerischen Folgen einer Freigabe der Abtreibung fĂŒr den Rechtsstaat zu warnen. Sie haben auf die bewusstseinsbildende Kraft des Strafrechts hingewiesen und darauf, dass das Lebensrecht des ungeborenen Kindes im Konfliktfall auch gegen die Interessen abtreibungswilliger Schwangerer verteidigt werden muss. Die katholische Opposition gegen jede Reform, die das Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren ĂŒber das Lebensrecht des ungeborenen Kindes stellte, war rund 25 Jahre lang von beeindruckender Konsequenz. Sie entsprach ebenso der kirchlichen Lehre ĂŒber das Verbrechen der Abtreibung, wie sie das II. Vatikanische Konzil in Gaudium et Spes und im Weltkatechismus von 1993 zum Ausdruck gebracht hatte[1], wie den Art. 1, Abs. 1 und Art. 2, Abs. 2 des Grundgesetzes, die den Schutz der MenschenwĂŒrde und des Lebensrechtes zur unverhandelbaren Staatsaufgabe erklĂ€ren.
Die Wende vom Kampf gegen die Abtreibungsgesetzgebung zur Verteidigung des Beratungskonzepts
Ein folgenschwerer Bruch in dieser AusĂŒbung des kirchlichen WĂ€chteramtes erfolgte bei der Mehrheit der Deutschen Bischofskonferenz und insbesondere ihrem Vorsitzenden, Karl Kardinal Lehmann, im Sommer 1993 und im Zentralkomitee der deutschen Katholiken zwei Jahre spĂ€ter, im Sommer 1995. Was war der Hintergrund dieses Bruches? Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Urteil vom 28. Mai 1993 den Paradigmenwechsel gebilligt, den der Bundestag in seiner Reform des § 218 am 26. Juni 1992 vollzogen hatte. Das Leben des ungeborenen Kindes sollte nicht mehr durch ein mit Strafsanktionen bewehrtes Abtreibungsverbot, sondern durch eine obligatorische Beratung der abtreibungswilligen Schwangeren geschĂŒtzt werden. Sollte sich die Schwangere nach der Beratung dennoch zu einer Abtreibung entschlieĂen, bleibt sie straffrei. Die Straffreiheit galt als Voraussetzung dieses Beratungskonzepts. Der Paradigmenwechsel opferte damit im Ergebnis das Lebensrecht des Kindes dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren.
Den Keim fĂŒr diesen Paradigmenwechsel hatte das Bundesverfassungsgericht bereits in seinem ersten Abtreibungsurteil vom 25. Februar 1975 gelegt. Es hatte damals zwar die 1974 beschlossene Fristenregelung als verfassungswidrig verworfen, aber dem Gesetzgeber bescheinigt, dass er nicht gehindert sei, âdie grundgesetzlich gebotene rechtliche Missbilligung des Schwangerschaftsabbruchs auch auf andere Weise zum Ausdruck zu bringen als mit dem Mittel der Strafdrohungâ.[2] Dass das Gericht dann 1993 die 1992 beschlossene Reform wiederum verwarf, lag nicht an der erneut eingefĂŒhrten Fristenregelung, sondern allein daran, dass die Abtreibungen innerhalb der ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft nach Beratung als ânicht rechtswidrigâ deklariert worden waren und die Beratungsregelungen nach Meinung des Gerichts ihre Orientierung am Lebensschutz nicht hinreichend deutlich werden lieĂen. Der Paradigmenwechsel von der Strafandrohung zum Beratungsangebot wurde vom Gericht aber ausdrĂŒcklich als verfassungskonform bestĂ€tigt[3] und in die vierte groĂe Reform, das Schwangeren- und FamilienhilfeĂ€nderungsgesetz vom 21. August 1995, ĂŒbernommen.
Erste Irritationen im Hinblick auf die Konsistenz der katholischen Opposition gegen den Paradigmenwechsel zeigten sich im Herbst 1992. Am 10. Juni 1992 hatte Kardinal Lehmann in einer Stellungnahme zu einem Gesetzesvorschlag von SPD- und FDP-Abgeordneten einen solchen Paradigmenwechsel noch ausdrĂŒcklich abgelehnt und gewarnt, die katholischen Beratungsstellen könnten sich ânicht in ein Verfahren einbinden lassen, das die Ausstellung einer Beratungsbescheinigung zu einer wesentlichen Voraussetzung fĂŒr die straffreie Tötung eines ungeborenen Menschen machtâ.[4] Gut drei Monate spĂ€ter zeichnete sich die Billigung des Paradigmenwechsels ab. In seinem Einleitungsvortrag vor der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda zum Thema âBeratung zwischen Lebensschutz und Abtreibungâ am 21. September 1992 geht es Kardinal Lehmann nur noch darum, dass die auf Grund des Paradigmenwechsels vorgenommenen Abtreibungen nicht auch noch das PrĂ€dikat ânicht rechtswidrigâ erhalten. Der gröĂte Teil des Vortrages dreht sich um das noch laufende Verfahren des Bundesverfassungsgerichts gegen die Reform des § 218 vom 26. Juni 1992 und die einstweilige Anordnung des Gerichts gegen diese Reform vom 4. August 1992. Dabei erweckt Kardinal Lehmann den Eindruck, als sei er ĂŒber die Ăberlegungen und Absichten des mit dem Verfahren befassten Senats bestens informiert gewesen. Er gab schlieĂlich seiner Hoffnung auf ein Urteil Ausdruck, das den katholischen Beratungsstellen eine Fortsetzung ihrer Arbeit ermögliche.[5]
Nachdem das Urteil am 28. Mai 1993 verkĂŒndet und der Paradigmenwechsel gebilligt worden war, stellte sich Kardinal Lehmann voll hinter das Gericht. SchlĂŒsseldokument dieses Kurswechsels und damit des Bruches in der Wahrnehmung des kirchlichen WĂ€chteramtes ist sein Vortrag âMut zu einem neuen Modellâ vor dem in Mainz tagenden Zentralrat des Sozialdienstes katholischer Frauen am 16. Juni 1993.[6] Zwar wurden einige Aspekte des Urteils kritisiert, aber der Paradigmenwechsel wurde unter Berufung auf Ernst-Wolfgang Böckenförde als Notordnung des sĂ€kularen Staates verteidigt. Das Tötungsverbot ordnete Kardinal Lehmann eigenartigerweise nicht dem sĂ€kularen Staat, sondern einer vorwiegend religiösen Sicht zu, so als sei es nicht zugleich die LegitimitĂ€tsbedingung des sĂ€kularen Verfassungsstaates. Entgegen der ausdrĂŒcklichen Feststellung des Urteils, die Schwangere bestimme ĂŒber den Abbruch einer Schwangerschaft in âLetztverantwortungâ selbst[7], und entgegen allen Auslegungen dieser âLetztverantwortungâ im Parlament und in der Rechtswissenschaft[8] behauptete er, der Begriff âLetztverantwortungâ gebe âder Frau beileibe keine Entscheidungskompetenzâ ĂŒber das ungeborene Leben.[9]
AusfĂŒhrlich Ă€uĂerte sich Kardinal Lehmann zur Funktion des Beratungsscheines, den er Nachweis einer lebensorientierten Beratung nannte. Dies entsprach zwar dem Wunsch der Kirche, war rechtlich aber immer unhaltbar, weil das Schwangerschaftskonfliktgesetz nur die Vorstellung der Schwangeren in einer anerkannten Beratungsstelle und das Angebot einer Beratung verlangte,[10] die Schwangere aber, wie das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum bayerischen Schwangerenberatungsgesetz vom 27. Oktober 1998 feststellte, sich gar nicht auf das Beratungsangebot einlassen muss. Sie habe, so das Gericht, einen Rechtsanspruch auf den die Abtreibung ermöglichenden Beratungsschein, auch wenn âsie die GrĂŒnde, die sie zum Schwangerschaftsabbruch bewegen, nicht genannt hatâ.[11] Kardinal Lehmanns Apologie des âneuen Modellsâ ging so weit, dass er nicht weniger als sechs Mal davor warnte, das Beratungskonzept mit dem Begriff âFristenregelungâ zu umschreiben. Er lieĂ auch wissen, an wen sich seine Warnungen richten: an die ausdrĂŒcklich in AnfĂŒhrungszeichen gesetzten âLebensschĂŒtzerâ.[12]
Nur zwei Bischöfe opponierten gegen die Anpassung an den Paradigmenwechsel: Erzbischof Dyba wies die Beratungsstellen seines Bistums bereits am 29. September 1993 an, keine Beratungsscheine mehr auszustellen, weil die Fristenregelung mit Beratungsangebot vom Bundesverfassungsgericht durch eine einstweilige Anordnung bereits zum 16. Juni 1993 in Kraft gesetzt worden war, der Beratungsschein mithin von diesem Tag an seine neue Bedeutung als Tötungslizenz erhielt. Joachim Kardinal Meisner lieĂ die Pressestelle seines Bistums am 16. Februar 1994 eine Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Regierungskoalition zur Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils verbreiten, in der dieser Entwurf sehr kompetent und kritisch analysiert und unumwunden âeine klassische Fristenregelungâ genannt wurde.[13]
Aber weder Erzbischof Dyba noch Kardinal Meisner konnten den Kurswechsel der Deutschen Bischofskonferenz verhindern. Mit diesem Kurswechsel verschoben sich die Fronten. Hatten die Bischöfe bis zum Sommer 1993 die katholische Lehre zum Lebensrecht des Embryos gegen den deutschen Gesetzgeber verteidigt, begannen sie nun, das deutsche Abtreibungsstrafrecht und sein Beratungskonzept gegen römische Kritik zu verteidigen. Es begann die mehr als vier Jahre dauernde, zermĂŒrbende, schlagzeilentrĂ€chtige, viele KrĂ€fte absorbierende und tiefe Wunden schlagende Auseinandersetzung um die Beteiligung der Kirche an der nachweispflichtigen Schwangerschaftskonfliktberatung, an der vor allem Kardinal Lehmann, die Mehrheit der Bischöfe und das PrĂ€sidium des Zentralkomitees der deutschen Katholiken einerseits und Papst Johannes Paul II., die Glaubenskongregation unter Kardinal Ratzinger sowie eine Minderheit der deutschen Bischöfe andererseits beteiligt waren.[14]
Die Auseinandersetzung mit Rom
Mit groĂer Spannung wurde die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vom 25. bis 28. September 1995 in Fulda erwartet, die erste Vollversammlung nach der Verabschiedung der Reform. Papst Johannes Paul II. hatte den Bischöfen am 21. September 1995 noch einen Brief geschrieben, in dem er zwar eine deutliche Anweisung bezĂŒglich der zu fĂ€llenden Entscheidung vermied, aber doch deutlich spĂŒren lieĂ, dass er das Ende der kirchlichen Beteiligung an der nachweispflichtigen Schwangerschaftskonfliktberatung erwartete. Er fĂŒhle sich, schrieb Johannes Paul II. âim Gewissen verpflichtetâ, an einige GrundsĂ€tze zu erinnern, die die Bischöfe bei der âNeudefinitionâ der kirchlichen BeratungstĂ€tigkeit beachten sollten. Der Begriff âNeudefinitionâ zeigte, dass der Papst ganz offenkundig nicht von einer Fortsetzung der bisherigen Mitwirkung am gesetzlichen Beratungssystem ausging. Die Bischöfe sollten die BeratungstĂ€tigkeit zwar intensivieren, aber dies mĂŒsse so geschehen, âdass die Kirche nicht mitschuldig wird an der Tötung unschuldiger Kinderâ.[15] Johannes Paul II. gab auch zu verstehen, wo er die Gefahr einer solchen Mitschuld sah: eben im Beratungsschein, der ânun de facto die alleinige Voraussetzung fĂŒr eine straffreie Abtreibungâ geworden sei. Als wolle er jeden Zweifel an der Richtung seiner Empfehlungen fĂŒr die deutschen Bischöfe ausschlieĂen, zitierte er auch noch die ErklĂ€rung von Kardinal Lehmann vom 10. Juni 1992, dass die Kirche sich nicht in ein Verfahren einbinden lassen könne, das die Ausstellung eines Beratungsscheines zu einer wesentlichen Voraussetzung fĂŒr die straffreie Tötung eines ungeborenen Menschen mache.
Die Deutsche Bischofskonferenz vermied jedoch den vielerorts erwarteten Beschluss. Sie kritisierte zwar mehrere Regelungen des neuen Gesetzes als eine Verschlechterung des Lebensschutzes fĂŒr die ungeborenen Kinder, zog daraus aber nicht die Konsequenz, die Mitwirkung der kirchlichen Beratungsstellen an der nachweispflichtigen Schwangerschaftskonfliktberatung einzustellen. Die Bereitschaft, sich an dieser Beratung weiterhin zu beteiligen, war die Folge der Billigung des Paradigmenwechsels. Mit der subtilen Dialektik, die seine Stellungnahmen zu diesem Problem nun bis zum Herbst 1999 prĂ€gen sollte, erklĂ€rte Kardinal Lehmann, dass man einerseits âkeine endgĂŒltige Entscheidungâ treffen konnte, dass man andererseits aber âbei aller VorlĂ€ufigkeit der Entscheidung eine grundsĂ€tzliche Orientierung fĂŒr die Weiterarbeitâ vorgenommen habe.[16]
Die Vollversammlung setzte eine Arbeitsgruppe von fĂŒnf Bischöfen (Lehmann, Saier, Kasper, Meisner und Wetter) ein, die mit dem Papst und der Glaubenskongregation GesprĂ€che ĂŒber die Beteiligung der Kirche an der Schwangerschaftskonfliktberatung aufnehmen sollte. Diese GesprĂ€che fanden am 5. Dezember 1995 und nach einem mehr als einjĂ€hrigen Moratorium am 4. April 1997 in Rom statt. Sie zeigten erhebliche Differenzen in der Beurteilung des Beratungskonzepts, des Beratungsscheins und der kirchlichen Mitwirkung an der gesetzlichen Konfliktberatung. So fand auf Bitten der Arbeitsgruppe am 27. Mai 1997 ein âKrisengipfelâ in Rom statt, eine eintĂ€gige Konferenz aller Diözesanbischöfe mit Papst Johannes Paul II., den KardinĂ€len Ratzinger und Sodano sowie weiteren Vertretern der Kurie. Dabei ging es um die Anwendung der kirchlichen Lehre zur Abtreibung im Kontext einer pluralistischen Gesellschaft. Das Ergebnis wollte Johannes Paul II. selbst einige Monate spĂ€ter bekannt geben.
Am 11. Januar 1998 teilte er den deutschen Bischöfen seine Entscheidung mit. Da der Beratungsschein nach dem deutschen Abtreibungsstrafrecht âeine SchlĂŒsselfunktion fĂŒr die DurchfĂŒhrung straffreier Abtreibungen erhalten hatâ, bat er die Bischöfe eindringlich, âWege zu finden, dass ein Schein solcher Art … nicht mehr ausgestellt wirdâ. Es gehe in dieser Problematik um âeine pastorale Frage mit offenkundigen lehrmĂ€Ăigen Implikationen, die fĂŒr die Kirche und die Gesellschaft in Deutschland und weit darĂŒber hinaus von Bedeutung istâ. Botschaft und Handlungsweise der Kirche in der Frage der Abtreibung mĂŒssten âin ihrem wesentlichen Gehalt in allen LĂ€ndern dieselben seinâ. Aber der Papst forderte die Bischöfe nicht auf, sich aus der Schwangerschaftskonfliktberatung zurĂŒckzuziehen. Im Gegenteil, sie sollten ihren Einsatz in der Beratung verstĂ€rken, aber berĂŒcksichtigen, dass die PrĂ€senz der Kirche in der Schwangerenberatung nicht vom Angebot des Beratungsscheines abhĂ€ngen dĂŒrfe. Nicht der Zwang des Strafrechts dĂŒrfe die Frauen in die kirchlichen Beratungsstellen fĂŒhren, sondern die sachliche Kompetenz, die menschliche Zuwendung und die Bereitschaft zu konkreter Hilfe, die darin anzutreffen sind.[17] Ein Kommentar des pĂ€pstlichen Staatssekretariats zu diesem Brief, der gleichzeitig mit dem Brief veröffentlicht wurde, zeigte den Ernst der Lage und die Verbindlichkeit der Entscheidung. Der Papst habe sie âin seiner Verantwortung als oberster Hirte der Kircheâ getroffen.[18]
Obgleich die deutschen Bischöfe auf der Sitzung des StĂ€ndigen Rates am 26. Januar 1998 in WĂŒrzburg erklĂ€rten: âWir werden dieser Bitte Folge leistenâ, war der pĂ€pstliche Brief vom 11. Januar nicht das Ende der jahrelangen Auseinandersetzung, sondern der Anfang eines noch viel gröĂeren Dramas, das sich noch einmal fast zwei Jahre lang hinzog und in dessen Verlauf sich Johannes Paul II. und die KardinĂ€le Ratzinger und Sodano zu vier weiteren Briefen an die deutschen Bischöfe bzw. ihren Vorsitzenden genötigt sahen.
Am 20. Oktober 1999 schrieb Kardinal Sodano den gegen den Ausstieg aus der nachweispflichtigen Schwangerenkonfliktberatung Bedenken tragenden Bischöfen im Auftrag des Papstes einen Brief, der deutlich machte, dass die Frage der Beteiligung der Kirche an dieser Art der Schwangerschaftskonfliktberatung keine Frage war, die mehrere und damit verschiedene Antworten zulĂ€sst, also Gegenstand eines prudential judgement ist. Der Brief, der die Handschrift von Kardinal Ratzinger verriet, stellte klar, dass es um unverhandelbare moralische Prinzipien geht, die nur eine Antwort zulassen: ein Nein zum Beratungsschein, der zugleich Tötungslizenz ist. Weil das Gesetz in Deutschland den Lebensschutz durch die Beratung ĂŒber den Nachweis der Beratung zum Mittel der VerfĂŒgung ĂŒber das menschliche Leben macht, könne die Kirche daran nicht mitwirken. Der WĂŒrzburger Beschluss vom 22. Juni 1999 habe deshalb mit Recht die Kritik der Ăffentlichkeit auf sich gezogen. Es handle sich bei der nachweispflichtigen Schwangerschaftskonfliktberatung um eine cooperatio ad malum, die die Kirche belaste, die Klarheit und Entschiedenheit ihres Zeugnisses verdunkle und die deshalb mit ihrem moralischen Auftrag und ihrer Botschaft unvereinbar sei. Es sei falsch, in dieser Frage eine GĂŒterabwĂ€gung vorzunehmen, und unzulĂ€ssig, die geretteten Kinder gegen die Zahl der abgetriebenen aufzurechnen. Die Behauptung, Schwangere in Konfliktsituationen wĂŒrden nur dann zur kirchlichen Beratung kommen, wenn sie auf einen Schein hoffen könnten, wird zurĂŒckgewiesen. Es sei nicht akzeptabel, wenn die Kirche in dieser Sache zuallererst dem Zwang des Staates und der Attraktion des Scheines vertraut. âDie Kirche setzt auf Freiheit. Sie setzt nicht auf unangemessene Lockmittel.â[19] Der Brief von Kardinal Sodano war an jene 13 Bischöfe adressiert, die nach der Herbstversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, auf der der Ausstieg der Kirche aus der âScheinberatungâ beschlossen worden war, dem Papst noch einmal schriftlich ihre Bedenken vorgetragen hatten. Sie haben den Antwortbrief von Kardinal Sodano nicht veröffentlicht. Auch die 13 Bischöfe, die gegen die Entscheidung des Papstes, auf den Beratungsschein zu verzichten, nicht opponiert und den Brief an den Papst deshalb nicht unterzeichnet hatten, erhielten ihn nicht.
Die Hoffnung, mit diesem Brief könne der vierjĂ€hrige Konflikt der deutschen Bischöfe mit Rom endlich ein Ende finden, trog erneut. WĂ€hrend des Ad-Limina-Besuches am 20. November 1999 versuchte Kardinal Lehmann dem Papst ein ZugestĂ€ndnis abzuringen, dass die einzelnen BistĂŒmer in der Schwangerschaftskonfliktberatung unterschiedliche Regelungen praktizieren könnten. Damit sollte die verworfene Position einer Beratung mit Nachweis unter dem Mantel pastoraler Freiheit und Vielfalt erneut zur Geltung gebracht werden. Doch Papst Johannes Paul II. lehnte ab: Das Zeugnis der Bischöfe in dieser Frage mĂŒsse âeindeutig und einmĂŒtigâ ausfallen. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die BeratungstĂ€tigkeit der Kirche in Deutschland gemÀà seiner Weisung bald endgĂŒltig neu geordnet werde.[20] Kardinal Lehmann forderte er auf, âsich fĂŒr eine einheitliche Lösung einzusetzenâ, weil er es âin einem hohen MaĂ fĂŒr schĂ€dlichâ halte, in dieser wichtigen Angelegenheit âzwei verschiedene Vorgehensweisen innerhalb desselben Episkopats zu akzeptieren.â[21] In der Sitzung des StĂ€ndigen Rates beschlossen die Bischöfe dann endlich, im Laufe des Jahres 2000 âeine Neuordnung der katholischen Beratung im Sinne der Weisung des Papstes durchzufĂŒhrenâ.[22]
Die Problematik des Beratungsscheines
 Im Zentrum der Auseinandersetzungen um die Schwangerschaftskonfliktberatung stand die Bewertung des Beratungsscheines. Die Mehrheit der Bischöfe, allen voran Kardinal Lehmann, und das PrĂ€sidium des Zentralkomitees der deutschen Katholiken hielten ab 1995 an der Ăberzeugung fest, der Beratungsschein sei allein eine Dokumentation einer dem Lebensschutz des ungeborenen Kindes dienenden Beratung der Schwangeren. Sie ignorierten seine zentrale Funktion, der Schwangeren und vor allem dem Arzt die Straflosigkeit der Abtreibung zu gewĂ€hrleisten. Der Beratungsschein war und ist aber eine Tötungslizenz. An dieser Erkenntnis fĂŒhrt kein Weg vorbei, wenn man denn unter Abtreibung die Tötung eines ungeborenen Kindes und unter Lizenz die staatliche ErmĂ€chtigung zur Vornahme einer bestimmten Handlung versteht. Nur Erzbischof Dyba wurde nicht mĂŒde, auf diese Funktion des Beratungsscheines hinzuweisen.
Der Beratungsschein bewirkt nach § 218a, Abs. 1 StGB, dass die Tötungshandlung einer Abtreibung vom Strafrecht durch den sogenannten Tatbestandsausschluss nicht zur Kenntnis genommen, ja mehr noch, dass die Tötungshandlung in eine straflose Ă€rztliche Beihilfe zur Realisierung des Selbstbestimmungsrechts der Schwangeren verwandelt wird. Er ermĂ€chtigt die Schwangere zum Abschluss eines rechtmĂ€Ăigen Vertrages mit einem Arzt zwecks Tötung ihres ungeborenen Kindes.[23] Nur zu diesem Zweck wird er gebraucht. Als Dokument einer Beratung wird er von niemandem benötigt. Seine Ausstellung ist deshalb weder rechtlich noch moralisch eine neutrale Tat. Sie ist aus der Sicht der Juristen Beihilfe zu einer letztlich doch rechtswidrigen Abtreibung,[24] aus der Sicht des Moraltheologen und des Sozialethikers eine cooperatio formalis ad malum.[25] Sie lĂ€dt die Lasten der Lösung eines Schwangerschaftskonflikts nicht dem TĂ€ter, sondern dem Opfer auf, indem sie das Opfer aus der Rechtsordnung ausschlieĂt. Dies ist mit den GrundsĂ€tzen eines Rechtsstaates unvereinbar.
Die moraltheologischen Kriterien fĂŒr eine cooperatio formalis, eine Mitwirkung an einer bösen Tat, die unter sittlichen Gesichtspunkten niemals erlaubt ist, hat Johannes Paul II. in Evangelium Vitae zusammengefasst. Eine solche Mitwirkung liegt dann vor, âwenn die durchgefĂŒhrte Handlung entweder auf Grund ihres Wesens oder wegen der Form, die sie in einem konkreten Rahmen annimmt, als direkte Beteiligung an einer gegen das unschuldige Menschenleben gerichteten Tat oder als Billigung der unmoralischen Absicht des HaupttĂ€ters bezeichnet werden mussâ[26]. Weder der Beratungsschein als Blatt Papier noch die Intention der Beraterin, die Leben retten will, machen also die Ausstellung des Beratungsscheines zu einer Mitwirkung an einer schlechten Tat, sondern allein der konkrete Rahmen des § 218a, Abs. 1 StGB, der deutlich macht, dass der Beratungsschein keinen anderen Zweck hat, als den, die Schwangere und den Arzt nach der Abtreibung straflos zu stellen. Deshalb ist die Schlussfolgerung nicht zu vermeiden, dass die Beraterin, auch wenn sie sich in der Beratung noch so sehr fĂŒr das Lebensrecht des Kindes eingesetzt hat, mit der Ausstellung des Beratungsscheines eine Beihilfe zu einer bösen Tat leistet.
Viele Bischöfe und Beraterinnen begrĂŒndeten ihre Verteidigung des Beratungsscheines mit dem Argument, dadurch könnten jĂ€hrlich rund 5000 Kinder gerettet werden, weil viele Schwangeren den Beratungsschein nach der Beratung entgegen ihrer ursprĂŒnglichen Absicht nicht mehr wollen oder nicht gebrauchen und so von einer Abtreibung Abstand nehmen. Die Benutzung der anderen rund 15.000 von insgesamt etwa 20.000 Beratungsscheinen, die katholische Beratungsstellen jĂ€hrlich ausstellten, fĂŒr eine Abtreibung wurde als Missbrauch des Beratungsscheines interpretiert und in Kauf genommen. WĂŒrden die kirchlichen Beratungsstellen den Beratungsschein nicht mehr ausstellen, sei, so wurde behauptet, das Ăbel noch gröĂer. Hinter dieser BegrĂŒndung stand eine utilitaristische oder konsequenzialistische Ethik, in der es keine an sich schlechte und deshalb verwerfliche Handlung gibt. Der Zweck des Lebensschutzes sollte das Mittel des â tödlichen â Beratungsscheines heiligen. Diesen Ansatz hat Robert Spaemann einer kritischen Analyse unterzogen. Es gebe âHandlungen, deren Verwerflichkeit auch ohne Kenntnis der UmstĂ€nde und der Absichten des Handelnden erkennbar ist. Sie sind immer schlecht, und eine Absicht, die ein gutes Ziel mit Hilfe solcher Handlungen zu erreichen sucht, ist eben keine gute, sondern eine schlechte Absicht. Der gute Zweck heiligt nicht das schlechte Mittel.â Es gebe deshalb zwar âunbedingte Unterlassungsgeboteâ, z. B. an einer Abtreibung nicht mitzuwirken, aber âkeine unbedingten, ohne Ansehung der UmstĂ€nde geltenden Handlungsgeboteâ, wie die Apologeten des Beratungsscheines behaupten.[27] Im Beratungsschein zeige sich die demoralisierende Wirkung des konsequenzialistischen KalkĂŒls. Wenn er als Beihilfe zu einer bösen Tat damit legitimiert werden soll, dass er zur Verhinderung anderer Abtreibungen diene, relativiert er die Verwerflichkeit der cooperatio formalis und schwĂ€cht das Unrechtsbewusstsein unter den Christen.
Nicht weniger problematisch war die pastoraltheologische Verteidigung des Beratungsscheines: Die nachweispflichtige Schwangerschaftskonfliktberatung böte der Kirche, so lautete das zentrale Argument, eine groĂe Chance, jenen Frauen die christliche Botschaft vom Leben nahe zu bringen, die âsich kirchlichem Denken, FĂŒhlen und Handeln weithin entfremdet habenâ.[28] WĂŒrde die Kirche diese Chance nicht nutzen und sich in eine bequeme Nische zurĂŒckziehen, wĂŒrde sie ihre SolidaritĂ€tspflichten mit der Welt und den Menschen verletzen und âsich mitschuldig an der Tötung ungeborener Kinder machenâ.[29] Kritiker einer derartigen Pastoral, die das Abtreibungsstrafrecht instrumentalisiert, um die betroffenen Frauen zu erreichen, waren in der Minderheit. âStaatliche Netze fĂŒr kirchlichen Fischfang?â, fragte mit Recht der Freiburger Pastoraltheologe Hubert Windisch, fĂŒr den die kirchliche Mitwirkung an der nachweispflichtigen Schwangerschaftskonfliktberatung eine âpotentielle cooperatio formalisâ war, die Gefahr lief, die Kirche in eine âVerkĂŒndigungspathologieâ zu fĂŒhren. Der Ausstieg aus dem âScheinsystemâ sei deshalb die einzige Lösung, um die Freiheit der VerkĂŒndigung zurĂŒckzugewinnen.[30] Dies war auch die Antwort des Papstes auf die pastoraltheologische Apologie des Beratungsscheines: Es dĂŒrfe nicht sein, âdass die Kirche in dieser Sache zuallererst dem Zwang des Staates und der Attraktion des Scheines vertraut. Die Kirche setzt auf Freiheit. Sie setzt nicht auf unangemessene Lockmittel.â[31]
Das Beratungskonzept des deutschen Abtreibungsstrafrechts ist kein Lebensschutzkonzept, sondern ein Alibi fĂŒr die Aufhebung des Tötungsverbots und eine Perversion echter Beratungsarbeit. So wurde es vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und der Deutschen Bischofskonferenz in einer gemeinsamen Stellungnahme wĂ€hrend der ersten Diskussion der entsprechenden GesetzesentwĂŒrfe im Deutschen Bundestag im FrĂŒhjahr 1992 selbst noch eingeschĂ€tzt.[32] Dieses Beratungskonzept ist ein klassisches Beispiel fĂŒr eine âStruktur der SĂŒndeâ, d. h. fĂŒr ein System, an dem mitzuwirken den Mitwirkenden unabhĂ€ngig von seinen guten Absichten in Tötungshandlungen verstrickt. Es privatisiert die Befugnis, ĂŒber Leben und Tod unschuldiger Menschen zu entscheiden. Damit verleugnet es den Rechtsstaat.
Prof. Dr. Manfred Spieker, Vortrag in Minneapolis, USA, 2006
[1] Â Â II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes 27 und 51; KKK 2270-2274. Vgl. auch Johannes Paul II., Evangelium Vitae 58-63.
[2] Â Â BVerfGE 39, 46.
[3]   BVerfGE 88, 204 und 264ff. Vgl. auch M. Spieker, Licht und Schatten eines Urteils. Zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu § 218 vom 28.5.1993, in: Hans Thomas/Winfried Kluth (Hrsg.), Das zumutbare Kind. Die zweite Bonner Fristenregelung vor dem BundesverfasÂsungsgericht, HerÂford 1993, S. 317ff.
[4] Â Â Presseinformationen der Deutschen Bischofskonferenz vom 10.6.1992, Nr. 6.
[5] Â Â Karl Lehmann, Beratung zwischen Lebensschutz und Abtreibung. Vortrag vor der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda am 21.9.1992, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 1992, S. 14ff.
[6]   Karl Lehmann, Mut zu einem neuen Modell. Anmerkungen zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Regelung des Schwangerschaftsabbruches vom 28.5.1993, in: J. Reiter/R. Keller, Hrsg., § 218. Urteil und Urteilsbildung, Freiburg 1993, S. 236ff.
[7] Â Â BVerfGE 88, 270.
[8]   Herbert Tröndle, Ăber das UnbegrĂŒndbare der zweiten Bonner Fristenlösung, in: Hans Thomas/Winfried Kluth, Hrsg., Das zumutbare Kind, a.a.O., S. 168f.; Willi Geiger, Menetekel, Eine Kritik an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Mai 1993 zum sogenannten Schwangeren- und Familienhilfegesetz vom 27. Juli 1992, in: Schriftenreihe der Juristen-Vereinigung Lebensrecht, Band 10, Köln 1993, S. 56.
[9] Â Â K. Lehmann, Mut zu einem neuen Modell, a.a.O., S. 240.
[10] Tröndle/Fischer, StGB, 49. Aufl. (1999), Vor § 218 Rn. 14 b; Rainer Beckmann, Fristenregelung mit Beratungsangebot â Anspruch und Wirklichkeit der neuen Abtreibungsregelung, in: Zeitschrift fĂŒr Lebensrecht, 4. Jg. (1995), S. 24ff.
[11] BVerfGE 98, 325.
[12] K. Lehmann, Mut zu einem neuen Modell, a.a.O., S. 237, 238, 239 und 245.
[13] Presseamt des Erzbistums Köln, Pressedienst Dokumente Nr. 283 vom 16.2.1994.
[14] Diese Auseinandersetzung ist analysiert in M. Spieker, Kirche und Abtreibung in Deutschland. Ursachen und Verlauf eines Konflikts, Paderborn 2000, S. 132-182.
[15] Johannes Paul II., Brief an die deutschen Bischöfe vom 21.9.1995, in: Rainer Beckmann, Der Streit um den Beratungsschein, WĂŒrzburg 2000, S. 200.
[16] Karl Kardinal Lehmann, Pressebericht der Versammlung der Deutschen Bischofskonferenz vom 25. bis 28.9.1995, S. 12.
[17] Johannes Paul II., Schreiben an die deutschen Bischöfe vom 11.1.1998, in: R. Beckmann, a.a.O., S. 202ff.
[18] Kommentar des Staatssekretariats zum Schreiben von Papst Johannes Paul II. an die deutschen Bischöfe vom 11.1.1998, in: R. Beckmann, a.a.O., S. 208.
[19] Angelo Kardinal Sodano, Brief vom 20.10.1999 an jene deutschen Bischöfe, die dem Papst am 4.10.1999 ihre Bedenken geschrieben hatten, veröffentlicht in: M. Spieker, Kirche und Abtreibung in Deutschland, a.a.O., S. 176ff.
[20] Johannes Paul II., Ansprache an die dritte Gruppe der deutschen Bischöfe anlÀsslich ihres Ad-Limina-Besuches am 20.11.1999, Ziffer 8, in: Osservatore Romano (deutschsprachige Wochenausgabe) vom 26.11.1999.
[21] Johannes Paul II., Brief an Bischof Lehmann vom 20.11.1999, in: R. Beckmann, a.a.O., S. 253.
[22] ErklÀrung des StÀndigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz vom 23.11.1999, in: R. Beckmann, a.a.O., S. 255.
[23] Herbert Tröndle, âBeratungsschutzkonzeptâ, ein Tabu fĂŒr die Kriminologie?, in: Hans-Jörg Albrecht u. a., Hrsg., Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht, Festschrift fĂŒr GĂŒnther Kaiser zum 70. Geburtstag, Berlin 1998, S. 1387ff.; Rainer Beckmann, Der Schatten des Scheines auf dem Antlitz der Kirche. Ăber die Mitwirkung der katholischen Kirche an der staatlichen Schwangerschaftskonfliktberatung, in: Stefan Rehder/Matthias Wolff, Hrsg., Abschied vom Himmel. Im Spannungsfeld von Kirche und Welt, Aachen 1999, S. 133.
[24] GĂŒnther Jacobs, Lebensschutz durch Pflichtberatung?, in: Schriftenreihe der Juristen-Vereinigung Lebensrecht, Bd. 17, Köln 2000, S. 17ff.
[25] Giovanni B. Sala, Kirchliche Beratungsstellen und Mitwirkung am Abtreibungsgesetz â eine moraltheologische Untersuchung, in: Schriftenreihe der Juristen-Vereinigung Lebensrecht, Bd. 14, Köln 1997, S. 59ff.
[26] Johannes Paul II., Evangelium Vitae 74.
[27] Robert Spaemann, Die schlechte Lehre vom guten Zweck. Der korrumpierende KalkĂŒl hinter der Schein-Debatte, in: FAZ vom 23.10.1999. Vgl. auch ders., GlĂŒck und Wohlwollen. Versuch ĂŒber Ethik, Stuttgart 1989, S. 164ff.
[28] Walter Bayerlein, EinfĂŒhrung in die ErklĂ€rung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken âDie Arbeit der katholischen Beratungsstellen fortsetzenâ, in: Berichte und Dokumente 104 (1997), S. 45f.
[29] Sabine Demel, Frauenfeindliche Bevormundung oder Freigabeschein zum Töten? Die Schwangerschaftskonfliktberatung im Kreuzfeuer der Kritik, in: Stimmen der Zeit, 122. Jg. (1997), S. 96; ErklĂ€rung der Konferenz der deutschsprachigen Pastoraltheologen und Pastoraltheologinnen zur jĂŒngsten Entwicklung bezĂŒglich der Schwangerschaftskonfliktberatung vom 29.9.1999.
[30] Hubert Windisch, Der Konflikt um die Konfliktberatung, in: Rheinischer Merkur vom 2.10.1998.
[31] A. Kardinal Sodano, Brief vom 20.10.1999, a.a.O., Ziffer 5.
[32] Stellungnahme der Gemeinsamen Konferenz der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zu dem Gruppenantrag zur Neufassung des § 218 vom 18.5.1992, in: Mitteilungen des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 387/92.
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Mittwoch 9. September 2009 um 17:08 und abgelegt unter Allgemein, Kirche, Lebensrecht.