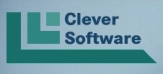Der verleugnete Rechtsstaat – Zur Kultur des Todes in Deutschland
Montag 8. März 2010 von Prof. Dr. Manfred Spieker

Der verleugnete Rechtsstaat – Zur Kultur des Todes in Deutschland
Kultur des Todes ist ein sperriger Begriff. Sie hat nichts zu tun mit der ars moriendi, jener Kunst des Sterbens eines reifen Menschen, der dem Tod ebenso bewusst wie gelassen entgegengeht, ja ihn, wie Franz von Assisi, als Bruder begrüßt. Sie hat auch nichts zu tun mit Mord und Totschlag, die es unter Menschen gibt, seit Kain Abel erschlug, auf denen aber immer der Fluch des Verbrechens lag. Kultur des Todes meint vielmehr ein Verhalten einerseits und gesellschaftliche sowie rechtliche Strukturen andererseits, die bestrebt sind, das Töten gesellschaftsfähig zu machen, indem es als medizinische Dienstleistung oder als Sozialhilfe getarnt wird. Die Kultur des Todes will das Töten vom Fluch des Verbrechens befreien. Sie bedient sich vieler Tarnkappen.
I. Die Abtreibung
1. Tarnkappe: Lebensschutz
Das erste Feld, auf dem sie sich ausbreitete, war das Feld des Abtreibungsstrafrechts. Am 26. April 1974 verabschiedete der Bundestag die erste Reform des § 218. Unter der Tarnkappe einer Verbesserung des Lebensschutzes und einer Eindämmung der Zahl der Abtreibungen legalisierte der Gesetzgeber die Tötung ungeborener Kinder in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft. Am 18. Juni 1974 trat die Reform in Kraft. Obwohl das Bundesverfassungsgericht die Fristenregelung am 25. Februar 1975 als grundgesetzwidrig verwarf, hat sich an der faktischen Freigabe der Abtreibung nichts geändert. Auch die Notlagenindikation der zweiten Reform des § 218 vom 18. Mai 1976 ermöglichte es jeder Schwangeren, ihr Kind töten zu lassen, wenn es ihren Lebensplanungen in die Quere kam. Dasselbe gilt für die dritte und die vierte Reform des § 218 nach der Wiedervereinigung. Mit dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz vom 27. Juli 1992 vollzog der Bundestag den Paradigmenwechsel vom strafbewehrten Abtreibungsverbot, das wenigstens noch auf dem Papier stand, zum Beratungsangebot, mit dem er behauptete, das ungeborene Kind besser schützen zu können, und den das Bundesverfassungsgericht schon in seinem Urteil von 1975 als grundgesetzkonform bezeichnet hatte. Das zweite große Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Abtreibungsstraffrecht vom 28. Mai 1993 verwarf dann lediglich die Bezeichnung der Abtreibung nach Beratung als „nicht rechtswidrig“ und verlangte eine deutlichere Orientierung der Beratung am Lebensschutz. Es bestätigte aber den Paradigmenwechsel, der das Lebensrecht des Kindes dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren opferte. In seiner vierten Reform vom 21. August 1995, die dem § 218 seine heute geltende Fassung gibt, bekräftigte der Bundestag den Paradigmenwechsel, der den Staat verpflichtet, ein flächendeckendes Netz nicht nur von Beratungs-, sondern auch von Abtreibungseinrichtungen vorzuhalten und eigene Sozialhilferegelungen zwecks Übernahme der Abtreibungskosten zu treffen. Unter den Tarnkappen „Schwangeren- und Familienhilfegesetz“ (1992) und „Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz“ (1995) wird weder der Schwangeren noch den Familien Hilfe angeboten. Sie verschleiern einmal mehr die Freigabe der Tötung und die perverse Verpflichtung des Staates, die Tötung nicht nur strafrechtlich, sondern im Hinblick auf den Arztvertrag der abtreibungswilligen Schwangeren auch zivilrechtlich und im Hinblick auf die Kostenübernahme sozialrechtlich zu regeln. Sie lassen „den Staat zum Komplizen der Tötung verkommen“ (Herbert Tröndle). Der Bonner Zivil- und Familienrechtler Wilhelm Bosch nannte die Reform des § 218 1992 die „dunkelste Stunde der deutschen Legislative“ seit 1945.
2. Tarnkappe: Zahnarztbesuch
Um die Freigabe der Abtreibung weiterhin als Verbesserung des Lebensschutzes ausgeben zu können, waren eine Reihe weiterer Tarnkappen nötig, die die Beschreibung des Abtreibungsvorganges in so genannten AufklärungsbroschĂĽren, die Finanzierung der Abtreibungen und die Abtreibungsstatistik betreffen. Pro Familia – selbst eine Tarnkappe, unter der sich, Engagement fĂĽr die Familie suggerierend, die Abtreibungslobby sammelt – bedient sich in InformationsbroschĂĽren, die beanspruchen, abtreibungswilligen Schwangeren die Prozedur der Abtreibung zu erklären, einer Sprache, in der weder das Kind noch der Embryo vorkommt: „Zuerst wird durch eine Tastuntersuchung und Ultraschall die Lage der Gebärmutter und die genaue Schwangerschaftsdauer festgestellt. Mit einer reizlosen Lösung wird die Scheide desinfiziert. Nach einer kaum spĂĽrbaren Betäubungsspritze wird der Gebärmuttermund mit dĂĽnnen Stäbchen wenige Millimeter aufgedehnt. AnschlieĂźend wird mit einem dĂĽnnen Röhrchen das Schwangerschaftsgewebe abgesaugt. Sobald die Gebärmutter leer ist, zieht sie sich kräftig zusammen, wodurch vorĂĽbergehend periodenähnliche Schmerzen auftreten können. Der Eingriff dauert ungefähr zehn Minuten. Nach dem Abbruch gehen Sie zurĂĽck in den Ruheraum und erholen sich bei einer Tasse Tee oder Kaffee“, so Pro Familia Bremen. NĂĽchterner, aber nicht weniger verschleiernd, Pro Familia Frankfurt in einer BroschĂĽre „Schwangerschaftsabbruch, was Sie wissen mĂĽssen – was Sie beachten sollen“: „Zum Abbruch einer Schwangerschaft muss zunächst der Gebärmutterhalskanal schonend erweitert werden. Dann wird der Inhalt der Gebärmutter entfernt.“ Die Verdummung im Gewande der Aufklärung hat auch Eingang gefunden in den Jugendroman von Nina Schindler „Intercity“ (Weinheim/Basel 1998), in dem eine Pro Familia – Beraterin die Abtreibung gegenĂĽber der 17-jährigen schwangeren Lisa mit dem Ziehen eines Zahnes vergleicht. „Also, wenn nun der Abbruch beschlossene Sache ist, dann erhalten Sie den Termin, finden sich hier ein, bekommen einen örtliche Betäubung, weil der Muttermund geöffnet werden muss. Dann wird abgesaugt, mit einem Spezialgerät, und anschlieĂźend bleiben Sie noch eine Stunde im Ruheraum. Dann schaut die Ă„rztin Sie sich noch einmal an, und dann können Sie gehen. Es ist zwar eine groĂźe Sache fĂĽr Ihre GefĂĽhle und fĂĽr gewisse moralische Vorstellungen, aber medizinisch gesehen ist es weniger schmerzhaft, als einen Zahn zu ziehen“. So wird die Abtreibung fĂĽr Lisa zur groĂźen Befreiung, zur RĂĽckkehr ins Leben. Sie hat nur noch Hunger nach Pommes und WĂĽrstchen und könnte „zwei Frittenbuden leer fressen.“
3. Tarnkappe: Sozialleistung
Alle Reformen des Abtreibungsstrafrechts tarnten die Tötung des ungeborenen Kindes als sozialstaatliche Leistung. Sie zwangen die Krankenkassen bzw. ab 1995 die Sozialämter zur Übernahme der Abtreibungskosten. Schon die erste Fristenregelung 1974 wurde von einer Änderung der Paragraphen 200f und 200g der Reichsversicherungsordnung begleitet. Die Krankenkassen sollten danach zwar nur jene Abtreibungen bezahlen, die nicht rechtswidrig waren, aber sie vereinbarten 1986, jede Abtreibung, nach der ein Arzt Arbeitsunfähigkeit bescheinigte, als „nicht rechtswidrig“ zu betrachten und zu bezahlen. Abtreibung wurde zur „Sachleistung“ der Krankenkassen, die ihren Mitgliedern somit nicht Geld, sondern die ärztliche Dienstleistung der Tötung ungeborener Kinder schuldeten. „Der Staat tötet“, so brachte Josef Isensee diese Reform auf den Punkt. Das Bundesverfassungsgericht erklärte in seinem Urteil vom 28. Mai 1993 zwar, dass die Finanzierung rechtswidriger Abtreibungen durch die Krankenkassen mit dem Grundgesetz unvereinbar sei, „weil dadurch das allgemeine Bewusstsein der Bevölkerung, dass das Ungeborene auch gegenüber der Mutter ein Recht auf Leben hat und daher der Abbruch der Schwangerschaft grundsätzlich Unrecht ist, erheblich beschädigt würde.“ Aber es verkündete gleichzeitig, dass die Finanzierung der Abtreibungen durch die Sozialhilfe verfassungsrechtlich ebenso wenig zu beanstanden sei wie die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung. Dies war einer der markantesten Widersprüche in dem an Widersprüchen reichen Urteil. So hat sich faktisch nichts geändert. Die Kultur des Todes bedient sich weiterhin der Tarnkappe der Sozialleistung. Der Bundestag verabschiedete ein „Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen“, eine Sozialhilfe de luxe, die die Bundesländer verpflichtet, den Krankenkassen die vorgestreckten Abtreibungskosten zurückzuerstatten. Dabei setzte er die bei der normalen Sozialhilfe geltenden Einkommensgrenzen um rund 30 % höher an und schrieb vor, die Einkünfte des Mannes nicht zu berücksichtigen. Sozialhilfe zwecks Tötung eines Kindes ist somit wesentlich leichter zu beziehen als Sozialhilfe zwecks Geburt und Erziehung eines Kindes. In rund 90 % aller Abtreibungen nach Beratung werden so den Krankenkassen die Kosten einer Abtreibung von den Sozialministerien der Bundesländer erstattet. Dies sind jährlich rund 40 Millionen Euro. Das Bewusstsein, dass Abtreibungen rechtswidrig sind, schwindet nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch bei Richtern. So untersagte das Landgericht Heilbronn in einem Urteil vom 18. Dezember 2001 einem Abtreibungsgegner, vor der Praxis eines Abtreibungsarztes auf die Rechtswidrigkeit der Abtreibungen hinzuweisen, mit der Begründung, „ein Schwangerschaftsabbruch, dessen Voraussetzungen detailliert geregelt sind und an dessen Durchführung zudem staatliche und kirchliche Stellen im Rahmen des obligatorischen Beratungsgesprächs mittelbar mitwirken, ist nach dem Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums wenn auch nicht erwünscht, so doch rechtmäßig“.
4. Tarnkappe: Statistik
Die Abtreibungsstatistik scheint sich auf den ersten Blick nicht dazu zu eignen, die Kultur des Todes zu fördern. SchlieĂźlich gelten Zahlen als objektiv, Meldevorschriften als kontrollierbar und Statistische Ă„mter als Behörden ohne politische Interessen. Aber auch die Abtreibungsstatistik dient der Kultur des Todes. Schon die 1976 eingefĂĽhrte Meldepflicht wurde derart missachtet, dass das Statistische Bundesamt jedes Jahr mit der gleichen Vorbemerkung vor den eigenen Zahlen warnte: „Die Ergebnisse sind hinsichtlich ihrer Größenordnung und Entwicklung mit Vorbehalt zu betrachten, weil verschiedene Indizien darauf hindeuten, dass nicht alle Ă„rzte… ihrer Meldepflicht nachkommen; ferner muss mit einer gewissen Zahl von illegalen AbbrĂĽchen gerechnet werden“.
Das wichtigste Indiz dafĂĽr, dass die Zahlen des Statistischen Bundesamtes – in den 80er Jahren durchschnittlich rund 85.000 – zu niedrig waren, bot die Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, bei der jährlich rund 50 % mehr Abtreibungen als dem Statistischen Bundesamt gemeldet abgerechnet wurden. FĂĽgt man diesen Abtreibungen noch jene hinzu, die von Privatkassen oder von Selbstzahlern bezahlt, die im Ausland durchgefĂĽhrt oder bei den Krankenkassen unter falschen Ziffern abgerechnet wurden, so kommt man nicht umhin, schon fĂĽr die 80er Jahre von jährlich rund 200.000 Abtreibungen auszugehen. Gewiss, es gibt keine präzisen Zahlen, aber es gibt plausible Schätzungen. Reichlich abwegig waren dagegen die Versuche der Regierung Kohl, die Abtreibungszahlen der 80er Jahre als Erfolg zu präsentieren, indem behauptet wurde, vor der Reform des § 218 habe es jährlich 400.000 (Helmut Kohl) oder gar 500.000 Abtreibungen (Rita SĂĽssmuth) gegeben. Da hätten sich selbst die 200.000 Abtreibungen noch als Erfolg ausgeben lassen. Kohl und SĂĽssmuth stĂĽtzten sich jedoch ganz unkritisch auf Behauptungen von Pro Familia, in denen jährlich neu „fallende Abtreibungszahlen“ vorgerechnet wurden. Sie hätten sich ruhig auf ihre sozialliberale Vorgängerregierung stĂĽtzen können, deren Gesundheitsministerium in der Reformdebatte Anfang der 70er Jahre zu berechnen hatte, welche Kosten auf die Krankenkassen zukommen, wenn sie die Abtreibungen zu bezahlen haben, und die nicht von 400.000, sondern von 90.000 bis 106.000 jährlichen Abtreibungen ausging.
Da auch die niedrigsten Zahlen der Abtreibungsstatistik immer noch geeignet waren, bei dem einen oder anderen Erschrecken auszulösen, und der Streit um die richtigen Zahlen immer wieder aufflammte, verfiel der Bundestag bei seiner dritten Reform des § 218 am 26. Juni 1992 auf die Idee, das Problem der Statistik dadurch zu lösen, dass er die Meldepflicht ganz abschaffte. Dem schob das Bundesverfassungsgericht schon am 4. August 1992 einen Riegel vor, indem es in einer einstweiligen VerfĂĽgung die FortfĂĽhrung der Meldepflicht anordnete und in seinem Urteil später erklärte, der Staat sei auf eine zuverlässige Statistik angewiesen, wenn er die Effektivität seiner MaĂźnahmen zum Schutz des ungeborenen Lebens ĂĽberprĂĽfen wolle. So wurde die Meldepflicht in die vierte Reform 1995 wieder aufgenommen und das Meldeverfahren sogar verbessert. Aber zuverlässig ist die Abtreibungsstatistik deshalb noch lange nicht. Auch in den folgenden fĂĽnf Jahren erklärte das Statistische Bundesamt regelmäßig, die Abtreibungszahlen seien nicht vollständig, weil bei den Landesärztekammern „keine oder nur unzureichende Erkenntnisse“ ĂĽber die Ă„rzte vorlägen, die Abtreibungen vornehmen, weil die Wahrhaftigkeit der Antworten der Ă„rzte nicht ĂĽberprĂĽfbar sei und bei Tests auch Antwortverweigerungen zu verzeichnen waren. AuĂźerdem fehlten die unter einer anderen Diagnose abgerechneten und die im Ausland vorgenommen Abtreibungen. Die rot-grĂĽne Bundesregierung hat es offenkundig fĂĽr inopportun gehalten, der eigenen Statistik mit derartiger Skepsis zu begegnen. Ab 2001 fehlte diese Erklärung, obwohl sich weder die Rechtsgrundlagen der Abtreibungsstatistik noch die Meldeverfahren geändert hatten. Die neue Behauptung in den Vorbemerkungen der Statistik, es sei dem Statistischen Bundesamt nun möglich, „die Einhaltung der Auskunftspflicht zu kontrollieren“, wurde durch Fakten nicht gedeckt. Es wurden auch keine GrĂĽnde genannt, die einsichtig gemacht hätten, wie die frĂĽher beklagten Defizite beseitigt werden konnten. Nach wie vor muss die jährlich gemeldete Zahl der Abtreibungen verdoppelt werden, will man der Realität nahe kommen. Das bedeutet, 260.000 Abtreibungen entsprechen eher der Wirklichkeit als die 130.570, die das Statistische Bundesamt im Durchschnitt der Jahre von 1996 bis 2005 meldete. Ein geringfĂĽgiger RĂĽckgang der Abtreibungen 2007 auf 116.871 und 2008 auf 114.500 bedeutet noch keinen RĂĽckgang der Abtreibungshäufigkeit, da auch die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter von 15 bis 45 von 1996 bis 2004 um rund 530.000 zurĂĽckgegangen ist.
In den 36 Jahren seit der Freigabe der Abtreibung 1974 sind somit nach der Statistik des Statistischen Bundesamtes in Ost- und Westdeutschland über 5 Millionen Kinder getötet worden, nach plausiblen Schätzungen aber rund 9,5 Millionen. Der Bundestag wurde durch das Bundesverfassungsgericht 1993 zu einer Erfolgskontrolle seines Paradigmenwechsels verpflichtet. Wäre er an dieser Erfolgskontrolle wirklich interessiert, müsste er nicht nur das Meldeverfahren vereinheitlichen und konsequent kontrollieren, sondern auch wissenschaftliche Untersuchungen in jenen Fallgruppen der Abtreibungen, die sich der Meldepflicht ganz entziehen, in Auftrag geben. An zuverlässigen Zahlen aber ist er einstweilen nicht interessiert. Sie könnten ihn an den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts erinnern, das Gesetz zu korrigieren und nachzubessern, wenn sich nach angemessener Beobachtungszeit herausstellt, dass das vom Grundgesetz geforderte Maß an Schutz des ungeborenen Lebens nicht gewährleistet ist. Zuverlässigere Zahlen könnten die Tarnkappe, der Paradigmenwechsel diene dem Lebensschutz, zerreißen. Nicht nur die rot-grüne Koalition, auch die Mehrheit der damaligen Opposition folgte lieber der Devise nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Die von 2005 bis 2009 regierende Große Koalition hat diesen Kurs des Ignorierens nicht geändert – sieht man von der Debatte über die Spätabtreibungen ab, die immerhin am 13. Mai 2009 zu einer Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes führte, die seit dem 1. Januar 2010 gilt. Nach einer Pränataldiagnose mit positivem Befund, also dem Verdacht auf eine körperliche oder geistige Schädigung des Kindes hat der Arzt eine umfangreiche Beratung der Schwangeren durchzuführen, mit der Bescheinigung einer medizinischen Indikation drei Tage zu warten und sich die Beratung schriftlich bestätigen zu lassen. An einer echten Überprüfung der Reform des Abtreibungsstrafrechts oder auch nur an einer Präzisierung der uferlosen medizinischen Indikation in § 218a Absatz 2 StGB ist aber auch die schwarz-gelbe Koalition des 17. Deutschen Bundestages nicht interessiert.
5. Tarnkappe: Beratungsschein
Die bei weitem wirkungsvollste Tarnkappe, derer sich die Kultur des Todes in Deutschland bedient, ist der Beratungsschein bei Abtreibungen in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft. Die abtreibungswillige Schwangere muss sich diesen Schein in einer anerkannten Beratungsstelle besorgen und dem Abtreibungsarzt vorlegen. In diesem Fall ist „der Tatbestand des § 218… nicht verwirklicht“. Der Beratungsschein gleicht somit schon fast einem Zaubermittel. Er verwandelt die Straftat der Tötung eines unschuldigen Menschen in eine medizinische Dienstleistung, deren Kosten der Staat ĂĽbernimmt. Der Schein ist, daran fĂĽhrt kein Weg vorbei, eine Tötungslizenz, deren der Arzt bedarf, um gesetzeskonform zu handeln. Die Tötungslizenz tarnt sich als Nachweis einer Beratung, die nach § 219 dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen und der Frau bewusst machen soll, „dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenĂĽber ein eigenes Recht auf Leben hat“, die gleichzeitig nach § 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes aber „nicht belehren und bevormunden“ soll.
Vom eigenen Lebensrecht des ungeborenen Kindes bleibt in der mit dialektischer Raffinesse konzipierten Beratungsregelung der Reform von 1995 nichts mehr übrig. Der Vorgang, der dem Schutz seines Lebens dienen soll, ist eo ipso die Bedingung seiner nicht nur straflosen, sondern staatlich geförderten Tötung. Der Tatbestandsausschluss des § 218a, Absatz 1, Satz 1, der die Abtreibung zur „Nichtabtreibung“ erklärt, sprengt die Rechtsordnung. Der Beratungsschein garantiert den Vorrang des Selbstbestimmungsrechts der Schwangeren vor dem Lebensrecht des Kindes. Er öffnet der nackten Gewalt des Stärkeren den Weg nicht nur zur zivilrechtlichen Anerkennung des Abtreibungsvertrages mit dem Arzt, sondern zur sozialrechtlichen Förderung, die sich in der Verpflichtung der Bundesländer zur Bereitstellung eines flächendeckenden Netzes von Abtreibungseinrichtungen und zur Erstattung der Abtreibungskosten niederschlägt. Um diesen Freibrief zur Gewaltanwendung zu erhalten, braucht sich die abtreibungswillige Schwangere nicht einmal auf eine Beratung einzulassen. Es genügt, wenn sie sich bei der Beratungsstelle vorstellt. Das Bundesverfassungsgericht hat ihr in seinem Urteil zum Bayerischen Schwangerenhilfeergänzungsgesetz vom 27. Oktober 1998 dieses Recht auf den Beratungsschein ausdrücklich zugesprochen auch dann, wenn „sie die Gründe, die sie zum Schwangerschaftsabbruch bewegen, nicht genannt hat“.
An diesem Beratungskonzept mitzuwirken ist Beihilfe zur Straftat der Tötung eines ungeborenen Kindes. Kommt die Schwangere, wie in rund einem Drittel der Fälle, nicht aus eigenem Entschluss, sondern auf Grund des Druckes ihres Mannes, Freundes, Arbeitgebers oder ihrer Eltern, dann ist die Ausstellung des Beratungsscheins auch noch Beihilfe zur Nötigung. Dass manche Schwangeren, die in eine Beratungsstelle kommen, den Beratungsschein dann doch nicht verlangen oder später nicht als Abtreibungslizenz benutzen, weil sie sich für ihr Kind entscheiden, rechtfertigt nicht die Mitwirkung an diesem Beratungskonzept, da das Gebot, keine Beihilfe zur Tötung eines Unschuldigen zu leisten, von größerer Unbedingtheit ist, als die Pflicht, Abtreibungen zu verhindern. Die Absicht, Abtreibungen zu verhindern, rechtfertigt nicht in einem einzigen Fall die Beihilfe zur Tötung durch die Ausstellung der Tötungslizenz. Dieses Beratungssystem und seinen Schein als „Geschenk des Lebens“ zu tarnen, wie es der Verein „Donum Vitae“ seit dem päpstlichen Nein zum Beratungsschein zu tun pflegt, ist die Kapitulation vor der Kultur des Todes.
II. Die Euthanasie
Wie die Abtreibung gehört die Euthanasie zu den klassischen Themen des Lebensschutzes. Jahrzehntelang war sie in Deutschland tabu, weil sie während der Herrschaft der Nationalsozialisten in großem Stil betrieben wurde. Sie war Teil der nationalsozialistischen Rassenideologie und zielte auf die Beseitigung von Behinderten, unheilbar Kranken und Schwachen, deren Leben als lebensunwert und die Volksgemeinschaft belastend galt. Ihre Tötung wurde als Tat der Liebe und des Mitleids oder – wie von Hitler selbst in seinem T4-Erlaß im Oktober 1939 – als Gnadentod deklariert. Dass sie in der Gesellschaft auf größere Akzeptanz stoßen würde, nahmen aber selbst die Nationalsozialisten trotz jahrelanger Indoktrination nicht an. Sie unterlag höchster Geheimhaltung, die Kardinal Galen mit seinen Predigten im Juli und August 1941 in St. Lamberti in Münster mutig und klug durchbrach. Der nationalsozialistischen Euthanasie fielen in Europa insgesamt 200.000 bis 300.000 Menschen zum Opfer. Allein die T4-Aktion im Krieg kostete 70.000 Menschen, darunter 20.000 KZ-Häftlingen und 5.000 Kindern das Leben. Die Euthanasie im nationalsozialistischen Deutschland war freilich nicht wie ein Gewitter aus heiterem Himmel über das Land gefallen. Sie war auch nicht nur eine nationalsozialistische Untat. Sie war vielmehr seit der Jahrhundertwende vorbereitet durch eine Ideologie, in der sich Rassenhygiene, Sozialdarwinismus und Medizin mischten, durch vieldiskutierte Bücher wie jenes von Karl Binding und Alfred Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens (1920) und durch den Göbbelschen Propagandafilm „Ich klage an“, der die Tötung einer unheilbar erkrankten, schwer leidenden Pianistin als Tat der Nächstenliebe ihres Gatten präsentierte.
1. Die Aufhebung des Tötungsverbotes
Die ein halbes Jahrhundert währende Tabuisierung der Euthanasie ging zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit der Verabschiedung der Euthanasiegesetze in den Niederlanden (2001) und in Belgien (2002) zu Ende. 2009 folgte Luxemburg. Zwar wurden derartige Gesetze von Vertretern aller Parteien im Bundestag scharf kritisiert, zwar gibt es Stellungnahmen des Deutschen Ärztetages, die die Euthanasie unmissverständlich ablehnen, und auch die Kirchen haben sich wiederholt in großer Eintracht gegen die Euthanasie ausgesprochen, aber demoskopische Untersuchungen zeigen ernüchternde Ergebnisse: Überwältigende Mehrheiten sprechen sich für die Euthanasie aus. In einer Umfrage der Konrad Adenauer-Stiftung im Dezember 2002 lehnten 76% der Befragten die Aussage ab „Aktive Sterbehilfe darf auch bei Todkranken nicht angewendet werden“. Nur 18% stimmten der Aussage zu und 4% wussten nicht, was sie antworten sollten. Selbst wenn man die Frage unglücklich formuliert findet, weil sie beim Befragten den Eindruck hinterlassen kann, er müsse Todkranke bei Ablehnung der aktiven Sterbehilfe allein lassen und weil sie die Alternativen der Palliativmedizin und der Hospizbetreuung nicht in den Blick rückt, so bleibt auch auf Grund anderer Untersuchungen das harte Faktum, dass rund zwei Drittel der Deutschen die Euthanasie bejahen. In einer Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie im März 2001 sprachen sich 70% für und nur 12% gegen die Euthanasie aus bei 18% Unentschiedenen. Die Befürworter einer ärztlichen Todesspritze für Schwerkranke auf Verlangen stiegen von 53% 1973 auf 67% 2001, die Gegner halbierten sich im gleichen Zeitraum von 33% auf 16%. In Ostdeutschland bejahen sogar 80% die Euthanasie. Selbst von den Katholiken sprechen sich nach der Befragung der Konrad Adenauer-Stiftung 73%, von den Protestanten gar 78% für die Euthanasie aus.
2. Tod – made in Switzerland
Das Parlament in Deutschland scheint einstweilen nicht gewillt zu sein, das Thema Euthanasie aufzugreifen. Aber es stand auf der Agenda des Ethikrates des Bundeskanzlers, der Enquete-Kommission Ethik und Recht in der modernen Medizin des 15. Deutschen Bundestages und der Bioethik-Kommission von Rheinland-Pfalz. Im Europarat hat sich der Ausschuss fĂĽr Soziales, Gesundheit und Familienangelegenheiten mit der BegrĂĽndung, niemand habe ein Recht, Todkranken und Sterbenden die Verpflichtung zum Weiterleben aufzuerlegen, fĂĽr die Freigabe der Sterbehilfe ausgesprochen. Die Parlamentarische Versammlung hat es aber bisher abgelehnt, solche Empfehlungen zu ĂĽbernehmen. Euthanasie-Gesellschaften mit mehr oder weniger wĂĽrdevollen Etiketten wie Gesellschaft fĂĽr humanes Sterben, Dignitas oder Exit, propagieren die Euthanasie und bieten ihre Beihilfe zum assistierten Selbstmord an.
Die Schweizerische Akademie für medizinische Wissenschaften scheute sich im Juni 2003 nicht, ihre standesrechtliche Empfehlung „Suizid unter Beihilfe eines Dritten“ mit der demographischen Entwicklung und den steigenden Gesundheitskosten zu begründen. Beides führe dazu, dass ältere Menschen in Krankenhäusern und Pflegeinstitutionen nicht mehr optimal versorgt werden können. Dies lasse den Wunsch entstehen, getötet zu werden, und in solchen Fällen bedürfe es klarer Regeln für Ärzte, Pflegepersonal und Verwaltungen der entsprechenden Einrichtungen. In der Logik dieser Empfehlung liegen diplomierte Sterbehelfer, die einen Tod „made in Switzerland“ anbieten. Auch unter Philosophen, Theologen und Juristen gibt es zunehmend Plädoyers für das Recht auf assistierten Selbstmord und für aktive Sterbehilfe, die allerdings nicht mit der demographischen Entwicklung und den Pflegekosten, sondern mit dem Recht auf Selbstbestimmung begründet werden. Ein Anspruch auf aktive Sterbehilfe „überspanne“ zwar den Würdeanspruch, aber ein Recht, „in selbstverantwortlicher Entschließung dem eigenen Leben ein Ende zu setzen“, wird von Matthias Herdegen in seiner Neukommentierung des Artikels 1, Absatz 1 GG aus der Menschenwürdegarantie abgeleitet. Wer ein solches Recht auf Selbstmord bejaht, wird aber die Forderung nach einem ärztlich assistierten Selbstmord nicht ablehnen können, und in der Logik des ärztlich assistierten Selbstmordes liegt – vor allem bei dessen Misslingen, wie die Erfahrungen in den Niederlanden belegen – die Euthanasie.
Das Verlangen nach einer Legalisierung der aktiven Sterbehilfe wird nicht umhin kommen, die Untersuchungen über die Euthanasiepraxis in den Niederlanden zur Kenntnis zu nehmen. Sie zeigen zum einen in der Sterbestatistik der 90er Jahre einen steigenden Anteil ärztlich herbeigeführter Todesfälle durch Euthanasie, assistierten Selbstmord, Entscheidungen gegen eine Weiterbehandlung Schwerkranker oder für eine Intensivierung der Schmerzbehandlung mit beabsichtigter Todesfolge. Sie zeigen zum anderen, dass die gesetzlichen Vorschriften für die Euthanasie nicht zu kontrollieren sind und in vielen Fällen gravierend missachtet werden. In rund 25% der Euthanasiefälle (900 von rund 3.700) erfolgte 2001 die Tötung des Patienten ohne dessen Verlangen. In etwa der Hälfte der Fälle unterblieb die vorgeschriebene Konsultierung eines zweiten unabhängigen Arztes. In vielen Fällen unterblieb die vorgeschriebene Meldung des Euthanasiefalles an die zuständige regionale Kontrollkommission, d. h. die Todesbescheinigung wurde gefälscht. Auch eine Frist zwischen dem Verlangen nach Euthanasie und der Durchführung der Euthanasie, die Rückschlüsse auf die Ernsthaftigkeit und die Dauerhaftigkeit des Verlangens zulässt und die im belgischen Euthanasiegesetz zum Beispiel einen Monat beträgt, wird nicht beachtet. In 13% der Euthanasiefälle lag zwischen Verlangen und Durchführung nur ein Tag, in rund 50% der Fälle nur eine Woche.
3. Euthanasie – unblutige Entsorgung der Leidenden
Die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe muss unvermeidlich dazu führen, dass aus dem Recht zum assistierten Selbstmord eine Pflicht wird. Der Pflegebedürftige, Alte oder Kranke hat nämlich alle Mühen, Kosten und Entbehrungen zu verantworten, die seine Angehörigen, Pfleger, Ärzte und Steuern zahlenden Mitbürger für ihn aufbringen müssen und von denen er sie schnell befreien könnte, wenn er das Verlangen nach aktiver Sterbehilfe äußert. Er lässt andere dafür zahlen, so Robert Spaemann, „dass er zu egoistisch und zu feige ist, den Platz zu räumen. – Wer möchte unter solchen Umständen weiterleben? Aus dem Recht zum Selbstmord wird so unvermeidlich eine Pflicht“.
Die Erfahrungen in den Niederlanden bestätigen die Vermutung, dass die Euthanasie nicht Hilfe für Schwerkranke, sondern Mittel einer unblutigen Entsorgung der Leidenden ist,# dass sie nicht Zuwendung zum Sterbenden, sondern Verweigerung des medizinischen und pflegerischen Beistandes ist. Sie verweisen auf die schwindende Plausibilität des Tötungsverbotes. Eine Trendwende ist einstweilen nicht in Sicht. Im Gegenteil, auch in Deutschland zeichnet sich eher eine Verschlechterung des Lebensschutzes ab. Dies gilt auch für das am 18. Juni 2009 verabschiedete Patientenverfügungsgesetz, das für die Selbstbestimmung des Patienten tödliche Fallen geschaffen hat. Um für Sterbende, für Schwerkranke und Pflegebedürftige einen besseren Lebensschutz zu ermöglichen, sind eine Verstärkung der Palliativmedizin in Forschung und Lehre sowie eine Ausweitung der Hospizbewegung zur stationären oder ambulanten Begleitung Sterbender unverzichtbar.
III. Die Kirche und der Lebensschutz
Die Kirche ist seit ihren Anfängen vor rund 2000 Jahren eine Verteidigerin der Kultur des Lebens. Nicht zuletzt der Umgang mit dem ungeborenen oder neu geborenen Kind unterschied die ersten Christen von ihrer römischen Umwelt. Die Abtreibung wird von der katholischen Kirche als Verbrechen verurteilt.# Ebenso kompromisslos lehnt sie die Euthanasie und die Embryonenproduktion ab. Als Verteidiger einer Kultur des Lebens ist Papst Johannes Paul II. anlässlich des 25. Jahrestages seiner Amtsübernahme am 16. Oktober 2003 und anlässlich seines Todes am 2. April 2005 weltweit gewürdigt worden. In seiner Enzyklika Evangelium Vitae hat er 1995 diese Kultur des Lebens der Kultur des Todes gegenüber gestellt. Benedikt XVI. hat diese klare Position schon als Präfekt der Glaubenskongregation und auch als Nachfolger Johannes Pauls II. immer gestützt.
Die katholische Kirche in Deutschland wusste sich in ihrer Kritik an embryonaler Stammzellforschung, Präimplantationdiadnostik und Klonen bis 2006 einig mit der EKD. Differenzen gab es in der Verurteilung der Abtreibung, die in den evangelischen Kirchen gern der Gewissensentscheidung der Schwangeren überlassen wird. Dass sich niemand auf sein Gewissen berufen kann, wenn er Grundrechte Dritter missachtet, wenn er gar ein ungeborenes Kind tötet, hat dagegen das Bundesverfassungsgericht in seinem Abtreibungsurteil vom 28. Mai 1993 unterstrichen. Der Verzicht auf den Beratungsschein hat das Zeugnis der katholischen Kirche für eine Kultur des Lebens gestärkt. Es wurde allerdings gleich wieder geschwächt durch die Gründung des Vereins Donum Vitae, der die Ausstellung der Tötungslizenzen fortführt. Er versteht sich als katholische Beratungsorganisation. Er handelt gegen die ausdrückliche Anweisung Papst Johannes Pauls II. und Benedikts XVI. Er verdunkelt das Zeugnis der Kirche für eine Kultur des Lebens. Er bindet die Kirche, zu der die Laien ebenso gehören wie die Bischöfe, in den Vollzug eines Gesetzes ein, das um des Selbstbestimmungsrechts der Schwangeren willen die Tötung unschuldiger Kinder zulässt. Die Initiative des Gemeindehilfsbundes vor der Herbstsynode der EKD 2009, mittels einer Unterschriftensammlung die evangelische Kirche aufzufordern, das staatliche Beratungssystem zu verlassen und ein eigenes kirchliches Beratungs- und Unterstützungssystem aufzubauen, war ein wichtiges Zeichen dafür, dass auch evangelische Christen sich mit der staatlichen Tötungslizenz nicht abfinden.
Das katholische Beratungsangebot ist nach dem Verzicht auf den Beratungsschein nicht verkleinert, sondern im Gegenteil ausgeweitet worden. Es wird auch genutzt und es erfasst nicht nur Schwangere, die überhaupt keine Abtreibung in Erwägung ziehen. Diese Trendwende zu einem Beratungssystem in ausschließlich kirchlicher Regie hat das christliche Zeugnis für eine Kultur des Lebens gestärkt. Es hat zugleich den Weg frei gemacht für eine unbehinderte Verteidigung des Lebensrechts in den anderen Gefährdungslagen der biomedizinischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Der Hirtenbrief der Deutschen Bischofskonferenz „Der Mensch: sein eigener Schöpfer? Zu Fragen von Gentechnik und Biomedizin“ vom 7. März 2001 bezeugt den Kampf für das Lebensrecht und die Würde des Menschen. Dem Versuch von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries im Oktober 2003, dem Embryo in vitro den Status der Menschenwürde abzuerkennen, um ihn für die embryonale Stammzellforschung leichter zugänglich zu machen, sind beide Kirchen sofort und einmütig entgegengetreten.
Zypries hatte behauptet, der Embryo in vitro hätte nicht die Möglichkeit, sich aus sich heraus zu einem Menschen oder als Mensch zu entwickeln. Deshalb komme ihm der Status der Menschenwürde nicht zu. Er stehe lediglich unter einem abgestuften Lebensschutz, der „Spielräume für Abwägungen mit den Grundrechten der Eltern und der Forscher„ eröffne. Die Deutsche Bischofskonferenz erklärte sofort, dass sie der Auffassung der Ministerin „entschieden widerspricht“ und deren Intention, das Stammzellgesetz „auszuweiten“, d.h. zur Disposition zu stellen, „heftig kritisiert“. Die Rede der Ministerin laufe darauf hinaus, „einer Absenkung der Schutzstandards auch in anderen Bereichen der Bio- und Gentechnik Tür und Tor zu öffnen.“ Auch der damalige Ratsvorsitzende der EKD Manfred Kock hielt Zypries entgegen, dass „alle Methoden der Forschung oder Therapie, durch die Menschen, von ihrer embryonalen Gestalt an, bloß als Mittel zur Verbesserung der Heilungschancen anderer Menschen gebraucht werden“, abzulehnen sind. Die Garantie der Menschenwürde komme allen Embryonen zu.
Die Stellungnahme von Bischof Wolfgang Huber zur Forderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 9. November 2006, die Stichtagsregelung des Stammzellgesetzes von 2002 aufzuheben, beendete allerdings die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Kirchen im Hinblick auf die embryonale Stammzellforschung. Sein Vorschlag, den Stichtag um vier Jahre zu verschieben, war genau der „Einstieg in den Ausstieg aus dem Embryonenschutz“, vor dem er selbst gewarnt hatte. Eine solche Anpassung, wie sie dann am 11. April 2008 beschlossen wurde, steht in der Gefahr zur Dauereinrichtung werden. Sie fördert das, was das Embryonenschutzgesetz von 1990 ausschließen wollte, dass die so genannten überzähligen Embryonen zu den Sklaven des 21. Jahrhunderts werden, schlimmer noch: dass sie um der Therapie anderer Menschen willen getötet werden. Wolfgang Wodarg (SPD) nannte dies Kannibalismus. Ein Kannibalismus in den Forschungslabors der Biomedizin ist nicht besser als ein Kannibalismus im Busch.
Die in der Pro – Life – Bewegung vereinten Christen in den USA haben gezeigt, dass der kompromisslose Kampf fĂĽr das Lebensrecht und die Bereitschaft auch zur Konfrontation mit Politikern und Wahlkandidaten des Pro – Choice – Lagers zu einer gesellschaftlichen und legislativen Trendwende beitragen können. Papst Johannes Paul II. hat den Kampf fĂĽr mehr Lebensschutz immer wieder als Aufgabe aller Christen in Erinnerung gerufen, so in seinem Apostolischen Schreiben Pastores Gregis an die Bischöfe und auch im Kompendium der Soziallehre der Kirche, das der Päpstliche Rat Justitia et Pax 2004 veröffentlicht hat. Der Aufruf Johannes Pauls II. „Habt keine Angst“, der zum Kennzeichen seines ganzen Pontifikats wurde und wesentlich zum Zusammenbruch des Kommunismus beigetragen hat, gilt auch dem Einsatz gegen eine Kultur des Todes und fĂĽr eine Kultur des Lebens.
Mit ihrem Einsatz für eine Kultur des Lebens kämpfen die Christen nicht für ein konfessionelles Sondergut, sondern für die Existenzbedingung des säkularen Rechtsstaates und auch der pluralistischen Gesellschaft. Wenn die Unantastbarkeit der Menschenwürde das Fundament unverletzlicher und unveräußerlicher Menschenrechte und somit auch „die Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“ ist (Art. 1, Absatz 2 GG), dann bedeutet die Infragestellung der Menschenwürde und die Anmaßung, sie nach selbst definierten Kriterien zu- oder aberkennen zu können, zugleich eine Gefährdung jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Auch in einer pluralistischen Gesellschaft gibt es unverhandelbare Prinzipien, die um des Schutzes der Menschenwürde und des Rechtsstaates willen einzuhalten sind. Zu diesen unverhandelbaren Prinzipien gehört das Verbot, Unschuldige zu töten. Deshalb ist der Einsatz, ja der Kampf gegen die Abtreibung, die Euthanasie, die embryonale Stammzellforschung, die Präimplantationsdiagnostik und die Pränataldiagnostik, das Klonen und m. E. auch gegen die In-Vitro-Fertilisation die Voraussetzung für ein Kultur des Lebens. Ein Blick in andere Länder wie Polen, Irland, Italien, Malta, Nicaragua, El Salvador und die USA zeigt, dass sich auch Erfolge erringen lassen. Kämpfen wir weiter: Haben wir keine Angst!
Prof. Dr. Manfred Spieker, Vortrag beim Kongress „Verfügungsmasse Mensch? Lebensanfang und Lebensende im Licht der christlichen Ethik“ des Gemeindehilfsbundes in Bad Gandersheim am 27. Februar 2010
Literatur:
Manfred Spieker, Der verleugnete Rechtsstaat. Anmerkungen zur Kultur des Todes in Europa, Paderborn 2005
Manfred Spieker, Kirche und Abtreibung in Deutschland. Ursachen und Verlauf eines Konflikts, 2. erw. Aufl., Paderborn 2008
Manfred Spieker, Hrsg., Biopolitik. Probleme des Lebensschutzes in der Demokratie, Paderborn 2009
Manfred Spieker, Katholische Kirche und Pro-Life-Bewegung in den USA, in: Zeitschrift fĂĽr Lebensrecht, 15. Jg. (2006), S. 110-117.
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 8. März 2010 um 10:25 und abgelegt unter Gesellschaft / Politik, Lebensrecht, Medizinische Ethik.