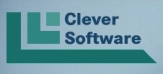Selbstbestimmung oder Lebensschutz
Montag 31. August 2009 von Die Tagespost
Bernward BĂĽchner
Selbstbestimmung oder Lebensschutz
Das Ziel der Ă„nderung des Schwangerschafts-konfliktgesetzes bleibt unklar
Das vom Bundestag am 13. Mai beschlossene Gesetz zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes soll am 1. Januar 2010 in Kraft treten. Für die einen ist es ein Gesetz „gegen Spätabtreibungen“. Für die anderen soll es lediglich das Selbstbestimmungsrecht der Frauen stärken.
Seit 13 Jahren galten wiederholte Initiativen der Fraktion von CDU und CSU im Bundestag der Bewältigung des Problems der Spätabtreibungen. Dabei handelt es sich um solche vorgeburtlichen Kindestötungen, die nach dem Strafgesetzbuch in den Fällen einer medizinisch-sozialen Indikation während der gesamten Dauer der Schwangerschaft „nicht rechtswidrig“ sind und teilweise noch in einem Stadium erfolgen, in dem das ungeborene Kind – ab etwa der zweiundzwanzigsten Woche – bereits außerhalb des Mutterleibs lebensfähig ist. In der Regel erfolgen diese Tötungen, wenn ein embryopathischer Befund erwarten lässt, dass das Kind behindert zur Welt kommt. Nach der Statistik lag die Zahl solcher Spätabtreibungen ab der dreiundzwanzigsten Woche in den Jahren 1996 bis 2008 jeweils zwischen 154 und 231. Aus der Ärzteschaft wurden wesentlich höhere Zahlen genannt.
Die Initiativen der Unionsfraktion verfolgten das Ziel, Spätabtreibungen zu vermeiden bzw. ihre Zahl zu verringern. Sie scheiterten jedoch am Widerstand aus anderen Fraktionen. In der laufenden Legislaturperiode des Bundestags wurden drei Gesetzentwürfe eingebracht, welche im Wege eines Kompromisses durch eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes zusammengeführt wurden. Diesen Gesetzentwurf hat der Bundestag in namentlicher Abstimmung mit Ausnahme einer vorgesehen gewesenen Gesetzesänderung betreffend die Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche mehrheitlich angenommen.
Ă„rztliche Beratungspflichten und Bedenkzeit
Die Begründung des angenommenen Gesetzentwurfs geht davon aus, dass Art und Qualität der Beratung von Frauen, die sich in einem Schwangerschaftskonflikt befinden, verbesserungsbedürftig sei. Hierzu sei neben untergesetzlichen Maßnahmen eine genauere Regelung der ärztlichen Beratungspflichten nötig. Außerdem gelte es das Recht der Schwangeren auf Nicht-Wissen bei jeder vorgeburtlichen Untersuchung zu wahren. Nach einer vorgeburtlichen Untersuchung mit einem auffälligen Befund seien die meisten Eltern überfordert und gerieten in schwere seelische Konflikte. Deshalb sei nach auffälligen Befunden eine bessere und umfassendere Aufklärung und Beratung dringend geboten.
Dementsprechend sieht die beschlossene Gesetzesänderung für den Fall, dass nach den Ergebnissen von pränataldiagnostischen Maßnahmen dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass die körperliche oder geistige Gesundheit des Kindes geschädigt ist, Folgendes vor: Die Ärztin oder der Arzt, die oder der der Schwangeren die Diagnose mitteilt, hat über die medizinischen und psychosozialen Aspekte, die sich aus dem Befund ergeben, zu beraten und hierbei Ärztinnen oder Ärzte hinzuzuziehen, die mit dieser Gesundheitsschädigung bei geborenen Kindern Erfahrung haben. Sie haben auch über den gesetzlichen Anspruch auf weitere und vertiefende psychosoziale Beratung zu informieren und im Einvernehmen mit der Schwangeren Kontakte zu Beratungsstellen und zu Selbsthilfegruppen oder Behindertenverbänden zu vermitteln. Ferner händigen sie der Schwangeren im Rahmen ihrer Beratung von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nach dem Gesetz zu erstellendes Informationsmaterial zum Leben mit einem geistig oder körperlich behinderten Kind und dem Leben von Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung aus. Zudem hat die Ärztin oder der Arzt, die oder der die gesetz-lich vorgesehene schriftliche Feststellung über die gesetzlichen Voraussetzungen eines nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs aufgrund einer medizinisch-sozialen Indikation zu treffen hat, vor dieser schriftlichen Feststellung die Schwangere über die medizinischen und psychischen Aspekte eines Schwangerschaftsabbruchs zu beraten, über den gesetzlichen Anspruch auf weitere und vertiefende psychosoziale Beratung zu informieren und im Einvernehmen mit der Schwangeren Kontakte zu Beratungsstellen zu vermitteln, soweit dies in der vorausgegangenen Beratung nicht bereits geschehen ist. Die zu treffende schriftliche Feststellung darf nicht vor Ablauf von drei Tagen nach der Mitteilung der Diagnose oder nach der Beratung durch die oder den Feststellende/n vorgenommen werden. Diese dreitägige Bedenkzeit braucht jedoch nicht eingehalten zu werden, „wenn die Schwangerschaft abgebrochen werden muss“, um eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für Leib oder Leben der Schwangeren abzuwenden. Die Erfüllung der ärztlichen Pflichten zur Beratung und Vermittlung hat die Schwangere dem feststellenden Arzt schriftlich zu bestätigen, ebenso ihren möglichen Verzicht hierauf. Ferner ist vorgesehen, dass die Verletzung ärztlicher Pflichten als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden kann.
Bei den nunmehr gesetzlich normierten ärztlichen Pflichten handelt es sich um solche, die sich eigentlich von selbst verstehen und deren Erfüllung deshalb schon bisher zu erwarten gewesen wäre. Es erscheint begrüßenswert, dass sie nun ausdrücklich im Gesetz stehen und ihre Verletzung als Ordnungswidrigkeit geahndet werden soll.
Beratung zum Schutz des Lebens?
Ein Teil der Mitglieder des Bundestags, wie der Abgeordnete Johannes Singhammer (CSU), hegt die Hoffnung, dass die verbesserte Beratung der Schwangeren die Zahl der Spätabtreibungen verringern wird. Aber darum geht es keineswegs allen Abgeordneten, die dem verabschiedeten Gesetzentwurf zur Mehrheit verholfen haben. Als dessen Ziel nannte beispielsweise die Abgeordnete Kerstin Griese (SPD), „dass die betroffenen Frauen eine Entscheidung fällen können, mit der sie später leben können.“ Es gehe nicht darum, quantitativ die Zahl der Spätabbrüche zu senken, sondern um bessere Beratung und darum, eine gute Entscheidung fällen zu können. Andere Abgeordnete haben sich im Parlament ähnlich geäußert. Über das Ziel eines zumindest quantitativ besseren Lebensschutzes war sich die für das Gesetz stimmende Mehrheit also keineswegs einig.
Dementsprechend kontrastiert die beschlossene Ergänzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes auch auffallend zu dem, was bezüglich der Fristenregelung mit Beratungsangebot gesetzlich geregelt ist. Die vor einer Abtreibung in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen angebotene Beratung, so heißt es im Gesetz, „dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und dass deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt“ (Paragraf 219 Absatz 1 Strafgesetzbuch). Das alles müsste doch auch und erst recht für die Beratung vor einer Spätabtreibung aufgrund eines embryopathischen Befundes gelten. Aber im Gesetz steht davon kein Wort. Weder ist vom Lebensrecht des ungeborenen Kindes die Rede noch wird ein Beratungsziel genannt. Die Beratung, die – wie diejenige vor einer befristeten Abtreibung – ergebnisoffen erfolgt, soll die eingehende Erörterung der möglichen medizinischen, psychischen und sozialen Fragen umfassen sowie die medizinischen und psychischen Aspekte eines Schwangerschaftsabbruchs beinhalten. Es erscheint zwar möglich, aber keineswegs gewährleistet, dass eine solche Beratung der schwangeren Frau das Bewusstsein vermittelt, das der Gesetzgeber bei einer „beratenen“ Kindestötung in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen voraussetzt.
Mit der „guten Entscheidung“ dank einer verbesserten Beratung soll die Frau leben können und nur wenn sie es zu können glaubt, auch das Kind, dessen Lebensrecht abhängen soll von der selbstbestimmten Entscheidung seiner Mutter. Dabei wird wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass „keine Frau leichtfertig entscheidet“, als gebe es nicht Männer und Frauen, die selbst wegen geringfügiger Behinderungen, ja selbst wegen des unerwünschten Geschlechts eine Schwangerschaft abzubrechen bereit sind, und keine Politiker, die das „Ausmerzen“ von Krankheiten befürworten.
Tötung auf Wunsch
Nach dem Gesetz ist allerdings für einen nicht rechtswidrigen Abbruch der Schwangerschaft aufgrund der medizinisch-sozialen Indikation nicht die Entscheidung der Frau maßgebend. Vielmehr muss der tötende Eingriff „unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt“ sein, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden (Paragraf 218a Absatz 2 Strafgesetzbuch). Ob diese Voraussetzung vorliegt, unterliegt also einer ärztlichen Entscheidung. Für sie ist die Sichtweise der Schwangeren zwar nicht unerheblich, weil die ärztliche Indikationsstellung im Wege eines dialogischen Prozesses erfolgt. Aber selbstverständlich ist die Tötung eines ungeborenen Kindes nicht schon „nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt“, wenn sie von der Schwangeren gewünscht wird. Bereits bisher erfolgten angeblich medizinisch indizierte Abtreibungen jedoch vielfach auf Wunsch. In der Debatte des Bundestags ist wiederholt bemerkt worden, „nur die Frau“ könne entscheiden. Offenbar wird erwartet, dass Ärzte es künftig nicht mehr wagen, einer Frau, die nach gesetzlicher Beratung und Bedenkzeit einen Schwangerschaftsabbruch wünscht, die Feststellung der Indikation zu verweigern. Dementsprechend wird der Druck auf die Ärzteschaft verstärkt. In „Der Spiegel“ vom 22. Juni 2009 ist unter dem Titel „Der Ludwig lacht“ zum Beispiel für ein Recht von Eltern Stimmung gemacht worden, sich gegen ein behindertes Kind zu entscheiden. Bei 115.000 Abtreibungen von gesunden Kindern pro Jahr könne man schon fragen, welchen Sinn es habe, ausgerechnet das Leben einiger hundert schwer fehlgebildeter Ungeborener gegen den Willen ihrer Mütter zu schützen. Die Psychiaterin Anke Rohde hat in einem Interview (Spiegel online vom 23. Juni 2009) von der Politik gefordert, dafür zu sorgen, dass im Sinne der Gleichbehandlung Frauen in allen Regionen Zugang zu diesen Eingriffen haben, zum Beispiel in speziellen Zentren, die „neutral geführt“ sein müssten und in denen der Maßstab nicht eine Weltanschauung sein dürfe. Diesem Ideal entspricht nach Auffassung der interviewten Ärztin offenbar Israel, wo Kollegen es wohl gar nicht verstünden, warum man bei uns so ein Problem mit späten Abbrüchen habe. Vielleicht liege das daran, dass nach einigen Strömungen des Judentums das menschliche Leben erst nach der Geburt beginne.
Verzicht auf eine verbesserte Statistik
Dass es den Abgeordneten mehrheitlich nicht darum gegangen ist, den Lebensschutz ungeborener Kinder zu verbessern, wird auch durch die Weigerung des Bundestags belegt, Schwangerschaftsabbrüche nach medizinisch-sozialer Indikation statistisch umfassender und präziser zu erfassen. Wie sich die verabschiedete Neuregelung in der Praxis konkret auswirkt, interessiert den Gesetzgeber offenbar nicht. Der Verzicht auf eine verbesserte Statistik lässt sich mit den vorgeschobenen datenschutzrechtlichen Bedenken nicht begründen. Den wahren Grund hat die Abgeordnete Sibylle Laurischk (FDP) deutlich ausgesprochen: „Wir wollen nämlich nicht, dass hier eine Plattform für weitere Diskussionen aufgemacht wird.“ Das Thema Spätabtreibungen soll offenbar endgültig vom Tisch und von den rund 98 Prozent nach der Fristenregelung erfolgenden Abtreibungen erst recht keine Rede mehr sein.
Wenn die mit dem Änderungsgesetz angestrebte bessere Aufklärung und Beratung Schwangerer bei embryopathischem Befund dazu führen würde, dass künftig mehr Kinder mit angeborener Behinderung das Licht der Welt erblicken, wäre dies ein erfreulicher Fortschritt. Solange die weit gefasste medizinisch-soziale Indikation dies ermöglicht und Ärzte einem Haftungsrisiko infolge der Geburt eines behinderten Kindes unvermindert ausgesetzt bleiben, werden jedoch auch künftig selbständig lebensfähige Kinder wegen einer Behinderung oder auch nur des Verdachts einer solchen getötet werden. Wie häufig, in welchem Stadium der Schwangerschaft, wegen welcher gesundheitlichen Beeinträchtigung und unter welchen Umständen dies geschieht, wollen unsere Volksvertreter nicht wissen und sollen auch die Bürger unseres Landes offenbar nicht erfahren.
Bernward BĂĽchner*, Die Tagespost Nr. 33 vom 13. August 2009, Seite 13
* Der Verfasser ist Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht a. D. und Vorsitzender der Juristenvereinigung Lebensrecht e. V. (Köln).
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 31. August 2009 um 8:25 und abgelegt unter Lebensrecht.