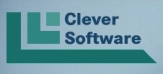Familie und Beruf? Über einige Tabus der Vereinbarkeitsdebatte
Dienstag 13. Juni 2006 von Prof. Dr. Manfred Spieker

Familie und Beruf? Über einige Tabus der Vereinbarkeitsdebatte
Es mangelt nicht an Diagnosen: Deutschland gehört zu den Ländern mit der weltweit niedrigsten Geburtenrate. Nirgends ist die Kluft zwischen Kapitalreichtum und Kinderarmut größer als hier. Das seit 1972 ununterbrochen anhaltende Geburtendefizit der deutschen Bevölkerung unterhöhlt den Generationenvertrag, auf dem das System der Sozialversicherung seit 1957 beruht. Mit einer Geburtenrate von 1,3 wird nicht nur das bei 2,1 liegende Reproduktionsniveau der Gesellschaft weit verfehlt, die deutsche Gesellschaft selbst unterliegt einem dramatischen Alterungsprozess. Der Anteil der über 60-jährigen, der 1998 noch 21% betrug, erhöht sich bis 2050 auf 40%, der Anteil der über 80-jährigen von 3% auf 14%. Die Bevölkerung insgesamt schrumpft bis 2050 von 82 auf voraussichtlich 67 Millionen. Diese unausweichliche Entwicklung stellt nicht nur die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung vor einen bisher unbekannten Reformbedarf, sie belastet auch die wirtschaftliche Entwicklung, das Bildungssystem, den Wohnungsmarkt und nicht zuletzt die Innovationsfähigkeit. Zusammen mit der Binnenwanderung entvölkert sie darüber hinaus ganze Regionen, vor allem in Ostdeutschland.
Der Generationenkonflikt scheint vorprogrammiert. Wenn der Alterslastquotient, also der Anteil der über 65-jährigen sich von 24% am Ende des vergangenen Jahrhunderts auf 51% 2050 mehr als verdoppelt, wenn zehn Erwerbstätige nicht mehr die Rente von fünf, sondern von zehn Rentnern zu finanzieren haben, dann ist es um die Generationengerechtigkeit geschehen, wenn denn Generationengerechtigkeit heißt, dass eine Generation der folgenden so viele Lebens- und Entfaltungschancen hinterlässt, wie sie selbst vorgefunden hat. Die Generation derjenigen, die nach 1950 geboren wurden, lebte und lebt immer noch auf Kosten derjenigen, die nach 1975 geboren wurden.
Es fehlt nicht an populären Büchern, die diese dramatische Entwicklung thematisieren.(1) Es fehlt auch nicht an Zeitschriften und Zeitungen, die dieser Entwicklung ihre Titelgeschichten und Schlagzeilen widmen.(2) Es fehlt auch nicht an universitären Bemühungen, die Familie neu zu entdecken.(3) Schließlich lässt sich auch nicht mehr behaupten, dass Politik und Wirtschaft vor dieser Entwicklung die Augen verschließen. Die Familienpolitik avancierte in den ersten Wochen der Regierung Merkel zum zentralen Thema. Die Pläne der Familienministerin von der Leyen zum Elterngeld und zur steuerlichen Absetzbarkeit der Betreuungskosten beherrschten um die Jahreswende 2005/2006 die Tagesordnung des Kabinetts, die Agenda der Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD und die Titelseiten vieler Zeitungen. Kommunen gründeten lokale Bündnisse für Familien. Wirtschafts- und arbeitsmarktnahe Stiftungen und Institute veröffentlichten zahlreiche Studien zur Entwicklung der Geburtenrate, zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Bevölkerungsentwicklung.(4) Fast drängt sich der Eindruck auf, die Familienblindheit der Sozialwissenschaften, die der 5. Familienbericht der Bundesregierung 1994 noch beklagte,(5) gehöre der Vergangenheit an. Es herrscht Einigkeit in der Einschätzung der Dramatik der demographischen Entwicklung, in der es nicht mehr fünf vor zwölf, sondern 30 Jahre nach zwölf ist.(6)
Die Einigkeit zerbricht allerdings schnell, wenn es darum geht, die Ursachen der demographischen Katastrophe zu benennen. Warum werden in Deutschland so wenig Kinder geboren? Liegt es an der finanziellen Belastung, die Kinder für ihre Eltern mit sich bringen? An der Transferausbeutung der Familien in unserem Sozialversicherungssystem? An der familienfeindlichen Emanzipationsideologie der 60-er und 70-er Jahre? An der durch Reformen des Scheidungsrechts begünstigten Instabilität von Ehe und Familie? An der Bindungsangst der jungen Generation? An der Einführung der hormonellen Empfängnisverhütung Mitte der 60er Jahre und der Freigabe der Abtreibung Anfang der 70er Jahre? An der mangelnden Vereinbarkeit von Beruf und Familie? An den fehlenden Kinderbetreuungseinrichtungen? Solange über die Ursachen des Geburtenrückgangs keine Klarheit und kein Konsens zu erzielen sind, solange wird eine Erfolg versprechende Therapie nicht zu entwickeln sein.
Ursachen des Geburtenrückgangs
Die Ursachen des rapiden und historisch beispiellosen Geburtenrückgangs seit Mitte der 60er Jahre sind vielfältig. Mit einer einzigen Ursache wird dem Phänomen nicht beizukommen sein, auch wenn die öffentliche Debatte gegenwärtig den Eindruck erweckt, als sei die Ursache klar: die mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Selbst wenn die Schwierigkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren, wirklich die einzige Ursache oder auch nur die Hauptursache des Geburtenrückgangs wäre, so ist damit noch keineswegs geklärt, wie diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden könnte – ob durch den heute favorisierten Ausbau der staatlichen Betreuungseinrichtungen oder durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für einen Wiedereinstieg der Mütter ins Berufsleben nach einer kinderbedingten Unterbrechung. Auch nicht geklärt ist, ob derartige Maßnahmen wirklich zur Erhöhung der Geburtenrate beitragen können. Es gibt neben der Problematik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aber auch noch eine Reihe anderer tabuisierter Ursachen des Geburtenrückgangs und darüber hinaus in der Vereinbarkeitsdebatte Ziele, die – nur unzureichend verschleiert – mit der Erhöhung der Geburtenrate nichts zu tun haben, sowie Fragen, die ganz verdrängt werden.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist schwierig. Wer wollte das bestreiten? Einerseits haben sich die Frauenbiographien im vergangenen halben Jahrhundert verändert. In der Ausbildung von Mädchen und Jungen, von jungen Frauen und Männern ist von der Schule bis zum Hochschulabschluss nicht nur eine Gleichberechtigung, sondern ein faktischer Gleichstand erreicht worden. Und wer eine lange Ausbildung oder ein Studium erfolgreich absolviert hat, ist auch daran interessiert, den erlernten Beruf wenigstens eine gewisse Zeit lang auszuüben, auch wenn das zur Folge hat, dass das durchschnittliche Alter der Erstgebärenden immer höher und das biologische Fenster für Empfängnis und Geburt von Kindern immer schmaler wird. Arbeit und Beruf sind aus der Perspektive der Christlichen Gesellschaftslehre darüber hinaus ein sehr hohes Gut, ein Mittel nicht nur des Einkommenserwerbs, sondern auch der Gestaltung der Welt, der Selbst-verwirklichung, ja der Beteiligung an Gottes Schöpfungswerk. Arbeit und Beruf ermöglichen es dem Menschen, mehr Mensch zu werden.(7) Im Zuge der Globalisierung nicht nur der Kapitalmärkte, sondern auch der Produktion und damit der Arbeitsmärkte erfordern Arbeit und Beruf darüber hinaus ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität, die die Gründung einer Familie und die Betreuung von Kindern erschweren.
Andererseits ist die Erziehung von Kindern und das Management eines Familienhaushaltes nicht nur eine Beschäftigung für den Feierabend, sondern selbst ein Beruf, der in bestimmten Lebensphasen des Kindes nur schwer mit einem Erwerbsberuf und den erwähnten Mobilitätserwartungen vor allem in leitenden Funktionen vereinbar (8) ist. Auch für diesen Beruf gilt, dass er ein Mittel ist, mehr Mensch zu werden und an Gottes Schöpfungswerk teilzunehmen. Aber der Beruf der Hausfrau und Mutter hat ein schwerwiegendes Defizit. Ihm fehlen Anerkennung und Einkommen.
Dennoch geben derzeit (2004) rund zwei Drittel aller Frauen mit der Geburt eines Kindes ihren Erwerbsberuf vorübergehend auf. Mit einem Kind unter drei Jahren sind rund 30% der Mütter erwerbstätig (10% voll, 15% in Teilzeit bis zu 20 Stunden wöchentlich und 5% zwischen 21 und 35 Stunden). Ist das jüngste Kind im Kindergartenalter, sind knapp 60% der Mütter wieder erwerbstätig (12% voll, 33% in Teilzeit bis zu 20 Stunden und 12% zwischen 21 und 35 Stunden). Ist das jüngste Kind zwischen sechs und 14 Jahren, also im schulpflichtigen Alter, steigt der Anteil der erwerbstätigen Mütter auf 70% (20% voll, 33% in Teilzeit bis zu 20 Stunden und 17% zwischen 21 und 35 Stunden).(9)
Die Wünsche, Beruf und Familie vereinbaren zu können, sehen bei den betroffenen Müttern meist etwas anders aus als die Realität. Der Anteil der Frauen, die ihre Tätigkeit in der Familie mit einer Erwerbsarbeit vereinbaren wollen, ist deutlich höher: 44% würden gern eine Teilzeit- und 19% gern eine Vollzeitbeschäftigung ausüben. Nur 22% würden sich für eine vorübergehende Unterbrechung ihrer Erwerbstätigkeit entscheiden.(10) Zwei von drei Müttern, die um ihrer Kinder willen aus dem Beruf ausgeschieden sind, würden also gern auf jede Unterbrechung ihrer Berufstätigkeit verzichten, ohne eine Möglichkeit dazu zu sehen.
Auf die Frage nach der Ursache für die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit scheint es heute nur eine Antwort zu geben: Es fehlen, so heißt es in Politik und Wirtschaft, in den Untersuchungen von Stiftungen und Instituten, Kinderbetreuungsinstitutionen, Kitas, Ganztagskindergärten (möglichst ohne oder mit nur ganz kurzen Ferien) und Horte. Dass es für die Entwicklung der Kinder schlicht besser sein könnte, wenn die Mutter zumindest in der Stillzeit ihren Erwerbsberuf ganz aufgibt, um sich ohne Stress dem Kind zu widmen, wird derzeit in der Politik nicht in Erwägung gezogen. Eine solche der Familie den Vorzug gebende Einstellung scheint als antiquiert zu gelten.
Die Behauptung, eine größere Dichte staatlicher Betreuungseinrichtungen würde zu einer Erhöhung der Geburtenrate führen, wird meist mit einem Hinweis auf Skandinavien oder Frankreich begründet, Ländern also, in denen der Anteil erwerbstätiger Mütter und zugleich die Geburtenrate höher seien als in Deutschland. In Norwegen beträgt die Geburtenrate 1,8 und die Erwerbsbeteiligung der Mütter rund 86%, in Dänemark 1,7 und die Erwerbsbeteiligung 88% gegenüber 63% in West- und 75% in Ostdeutschland. In Frankreich schließlich beträgt die Geburtenrate zwar 1,9, die Erwerbsbeteiligung der Mütter aber ist nicht höher als in Deutschland.
Hinweise auf andere Länder sind allerdings noch keine Begründung. Die höhere Geburtenrate in Norwegen könnte ihre Ursache auch in den höheren staatlichen Transferleistungen im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes haben, die höhere Geburtenrate in Frankreich in einem engmaschigen Netz staatlicher Transferleistungen, die Subjekt- nicht Objektförderung betreiben, dem Familiensplitting im Steuerrecht und einer Mentalität, die die Leistungen für die Familie als Investitionen, nicht als Sozialausgaben betrachtet.(11) Schnelle Rückschlüsse von der Dichte der Kinderbetreuungseinrichtungen auf die Höhe der Geburtenrate sind wissenschaftlich nicht tragfähig. Sie werden allein schon durch einen Vergleich der Lage in Ost- und Westdeutschland widerlegt. In Ostdeutschland gab es 2004 für 37% der Kinder unter drei Jahren einen Krippenplatz, in Westdeutschland nur für 3%, in Ostdeutschland waren 98% der Kindergartenplätze Ganztagsplätze, in Westdeutschland nur 20%, Ostdeutschland hatte für 41% der 6-11 jährigen Hortplätze, Westdeutschland nur für 5%.(12) Dennoch war die Geburtenrate in Westdeutschland mit 1,2 deutlich höher als in Ostdeutschland mit rund 1,0. Dass sie in Deutschland insgesamt bei 1,35 liegt, ist allein auf die mit 1,9 deutlich höhere Geburtenrate der Ausländer in Deutschland zurückzuführen. Dennoch gibt es auch in Deutschland noch Regionen, in denen die Geburtenrate weit über dem Durchschnitt liegt, so in den vorwiegend katholisch geprägten Landkreisen Cloppenburg und Vechta mit 1,8.
2. Die Prioritäten der Betroffenen
Die Erwartung der Großen Koalition und auch schon der vorherigen Regierung Schröder, mit einer Ausweitung der staatlichen Kinderbetreuungseinrichtungen könne die Geburtenrate erhöht werden, wird schließlich widerlegt durch die Prioritäten der Betroffenen. In der Hierarchie der Bedingungen, die erfüllt sein sollen, um die Bereitschaft zu Kindern zu entwickeln, stehen die Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder weit hinter der Stabilität der Beziehung und dem partnerschaftlichen Konsens, dass beide sich ein Kind wünschen. Während 92% der 18- bis 44-jährigen nach einer Allensbacher Untersuchung den Konsens im Hinblick auf den Kinderwunsch und 84% die Stabilität der Beziehung für entscheidend halten, rangiert die Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsmöglichkeiten mit 25% weit abgeschlagen nur an 9. Stelle von insgesamt 14 Voraussetzungen.(13)
Die Betreuungseinrichtungen am Wohnort werden denn auch von 61% der Eltern als ausreichend und nur von 29% als unzureichend empfunden. Lediglich bei Alleinerziehenden beurteilt eine Mehrheit von 52% das Angebot als unzureichend gegenüber 42%, die es immerhin noch als ausreichend beurteilen.(14) Die Frage, ob der Staat etwas dazu beitragen könne, um „diesen Einflussfaktor auf die Geburtenrate zu mindern“, d.h. die Stabilität partnerschaftlicher Beziehungen zu erhöhen, wird in der Untersuchung des Allensbacher Instituts für Demoskopie zwar gestellt, aber schnell abgetan. Die Möglichkeiten des Staates hierzu seien begrenzt. Das trifft sicher zu. Aber es sollte wenigstens nach den Grenzen gefragt werden. Es gibt solche begrenzten Möglichkeiten. Das beginnt bei den Curricula einzelner Fächer im schulischen Unterricht, die kaum weniger familienblind sind als die Sozialwissenschaften (15), führt über den vom Grundgesetz gebotenen und vom Bundesverfassungsgericht mehrfach eingeforderten Schutz von Ehe und Familie im Steuer- und Sozialversicherungsrecht und endet bei der Gestaltung des Scheidungsrechts, das nicht der geringste Beitrag des Staates zur Stabilität bzw. Instabilität ehelicher Beziehungen ist.
Die Tabus: Ehescheidung und Abtreibung
Der Wandel der weiblichen Biographie im vergangenen halben Jahrhundert hin zur Gleichberechtigung in Ausbildung, Studium und Erwerbstätigkeit – von Führungspositionen abgesehen – wird in der Debatte über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie meist nur im Hinblick auf den Preis für die Geburtenrate betrachtet. Der Preis besteht in der schon erwähnten Verengung des biologischen Zeitfensters der Frau, das für Empfängnis und Geburt von Kindern optimal ist. Dieses Optimum liegt im Alter von 26 bis 31, einem Alter also, in dem zumindest in Deutschland Studienabschluss und erste Karriereschritte im Mittelpunkt stehen. Ab 35 gelten Geburten aus medizinischer Sicht heute schon als Risikogeburten, die Gynäkologen veranlassen, die Schwangere zu einer Pränataldiagnostik zu drängen. Das Risiko, dass der Kinderwunsch erst Gestalt annimmt, wenn sich das biologische Fenster schließt, ist groß. Schneller, als bei den ersten Karriereschritten erwartet, ist es zu spät für die Geburt eines Kindes oder weiterer Kinder nach der ersten Geburt. Dabei halten immer noch 72% der 18- bis 44-jährigen eine Familie mit zwei (57%) oder mehr Kindern (15%) für die beste Familienkonstellation.(16) Der Anteil der Frauen aber, die zeitlebens kinderlos blieben, ist in Deutschland mit über 30%, unter Frauen mit Hochschulabschluss gar 40%, sehr hoch. Er gilt als „demographischer Weltrekord“(17) und als Hauptursache des starken Geburtenrückgangs. Er hängt sicher auch damit zusammen, dass deutsche Hochschulabsolventen sehr alt sind.
Weithin tabu scheint die Frage zu sein, ob der Wandel weiblicher Biographien, der Trend zur eigenen beruflichen Absicherung auch mit dem Stabilitätsverlust der Partnerbeziehung zusammenhängt. Wenn vier von zehn Ehen im Laufe der Zeit geschieden werden (2001: 197.498), wenn nur 52% aller Verheirateten bzw. mit einem Partner Zusammenlebenden überzeugt sind, dass die eigene Partnerschaft ein ganzes Leben hält (18), dann ist die Ausbildung der Frau nicht nur ein Grundrecht und eine wichtige Voraussetzung der Selbstverwirklichung, sondern auch eine Art Versicherungspolice gegen Armut nach dem Zerbrechen der Partnerschaft, eine Hilfe zum Überleben, wenn die Frau nach den ersten Schwierigkeiten in der Partnerschaft mit oder ohne Kinder allein gelassen wird.
Tabuisiert wird auch die Frage, ob die katastrophale demographische Entwicklung seit 1972 etwas mit der Reform des Abtreibungsstrafrechts zu tun hat. Seit der Einführung der Fristenregelung 1974 sind Abtreibungen faktisch freigegeben. Daran haben auch die Verwerfung der Fristenregelung durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 25. Februar 1975 und die am 12. Februar 1976 eingeführte Indikationenregelung nichts mehr geändert. Mit den Reformen des § 218 StGB von 1992 und 1995 ist die Fristenregelung, kaum kaschiert durch das Beratungsangebot, dann erneut Gesetz geworden.(19) In den 32 Jahren seit der ersten Reform des § 218 1974 sind allein nach den unrealistischen Angaben des Statistischen Bundesamtes in Deutschland (West und Ost) rund 4,4 Millionen ungeborene Kinder getötet worden. Dass die offiziellen Zahlen unrealistisch sind, hat das Statistische Bundesamt bis zum Jahr 2000 jedes Jahr selbst erklärt.(20) Weder sind in diesen Zahlen die von den Ärzten unter einer anderen Diagnose abgerechneten noch die im Ausland durchgeführten Abtreibungen enthalten, noch kann das Statistische Bundesamt garantieren, dass es alle abtreibenden Ärzte erfasst hat oder dass alle erfassten Ärzte ihre Abtreibungen vollständig melden.(21) Nach plausiblen Schätzungen müssen die Zahlen deshalb verdoppelt werden. Das ergibt rund 8,8 Millionen Abtreibungen von 1974 bis 2005.
Man wird nicht annehmen können, dass Deutschland bei einem fortgeltenden Abtreibungsverbot 8,8 Millionen mehr Menschen hätte. Die heimlichen Abtreibungen hätte es auch dann in diesen 32 Jahren gegeben. Nach einer Schätzung des Bundesgesundheitsministeriums der sozial-liberalen Bundesregierung Anfang der 70-er Jahre waren dies jährlich 75.000 bis 80.000. In 32 Jahren wären dies 2,4 bis 2,5 Millionen. Deutschland hätte mithin 2006 rund sechs Millionen Einwohner mehr, statt 82 also 88 Millionen. Die Geburtenrate hätte zu Beginn des neuen Jahrhunderts nicht 1,3 sondern 1,6 betragen. Die Vernichtung von 8,8 Millionen ungeborenen Kindern ist eine zentrale, in den einschlägigen Untersuchungen gern tabuisierte Ursache der demographischen Probleme Deutschlands.
Ziele und Instrumente der Familienpolitik
1. Mehr Kinder oder mehr Erwerbstätige?
Die gegenwärtige Familienpolitik begründet alle Forderungen nach einem Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, nach kostenlosen Kindertagesstätten und Kindergärten sowie nach der steuerlichen Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten mit dem Geburtenrückgang und der notwendigen Erhöhung der Geburtenrate. In der politischen Debatte nur selten (22), umso unverhohlener aber in den einschlägigen Studien der Bertelsmann-Stiftung, des Instituts der Deutschen Wirtschaft, des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung oder der Evangelischen Akademie Loccum wird die Forderung nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit einem anderen Ziel begründet: mit der Mobilisierung des weiblichen Arbeitskräftepotentials. Da sich das Erwerbspersonenpotential in Deutschland bis 2050 um ein Drittel verringere, müssten Frauen in erheblich größerem Umfang als bisher erwerbstätig werden. Dies sei „volkswirtschaftlich notwendig, um künftige Fachkräfteengpässe und die Folgen der demographischen Verschiebungen zu begrenzen.“ (23)
Die gegenwärtige Familienpolitik, die mit Kindergeld, Elterngeld, Steuerrecht und Ansprüchen auf Teilzeiterwerbstätigkeit das vollständige oder teilweise Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zwecks Kinderbetreuung erleichtert, führe nicht nur zu einer „Vergeudung von Humankapital, ineffizienter Allokation bei der Produktion haushaltsnaher Dienstleistungen und Risiken für die sozialen Sicherungssysteme“,(24 ) sondern auch dazu, dass „sich tradiertes geschlechtsspezifisches Rollenverhalten verfestigt“.(25 ) Die gegenwärtige Familienpolitik gilt deshalb aus dieser Perspektive, in der sich arbeitsmarktpolitische und feministische Motive mischen, als kontraproduktiv,(26 ) ja sogar als „Falle“, weil die berufliche Qualifikation der Frauen bei dreijähriger Unterbrechung meist gravierend entwertet wird.(27)
Die Familienpolitik gerät in dieser Perspektive zur Magd der Arbeitsmarktpolitik. Die Frage, was dem Wohl des Kindes besser dient, die Erziehung in der Familie oder die Betreuung in öffentlichen Einrichtungen, wird gar nicht gestellt, geschweige denn seriös erörtert. Ob Betreuung dasselbe ist wie Erziehung, diese Frage wird nicht gestellt. Auch die Frage, ob dem Kind eine sequentielle Vereinbarkeit von Familie und Beruf eventuell besser dient als eine simultane, wird nicht aufgeworfen.(28) Manche der Studien zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie restaurieren ungeniert die Krippenideologie der DDR, wenn beispielsweise in den Loccumer Protokollen behauptet wird, „die familienpolitische Unterstützung häuslicher Kinderbetreuung zu Lasten der Berufstätigkeit von Müttern konterkariert … die Förderung von Chancengleichheit“(29) oder wenn in der Studie der Bertelsmann-Stiftung unterstellt wird, in den staatlichen Kinderbetreuungseinrichtungen gelinge es „eher als in privaten Betreuungsformen pädagogische Standards zu verwirklichen“ und „den Kindern Sozialisationserfahrungen (zu) vermitteln, die sie als Einzelkinder oft nicht machen können“.(30) Selbst vor der Einschränkung des Elternrechts schreckt die Bertelsmann-Stiftung nicht zurück, auch wenn diese Einschränkung als sozialpolitische Wohltat verkleidet wird. Kitas seien erforderlich, weil kein Kind „zurückgelassen werden“ dürfe – „auch wenn dies die Freiheit der Eltern in der Erziehung ihrer Kinder beeinträchtigt.“(31)
Hier wird Unvergleichbares verglichen. Wer den guten Kindergarten oder eine Kindertagesstätte mit hohem Pflegestandard einer Familie mit verwahrlosten Kindern gegenüberstellt, wird natürlich der institutionellen Kinderbetreuung den Vorzug geben oder gar wie der Senat in Hamburg dazu neigen, Vorsorgeuntersuchungen des Kindes zur Pflicht zu machen und dem Staat „teilweise die Elternrolle sowohl für die Eltern eines Kindes als auch für das Kind“ zu übertragen (32), ihn also zum Übervater zu machen. Und wer das möglicherweise verwöhnte oder gestörte Einzelkind vor Augen hat, wird auch die Sozialisationserfahrungen in einer guten Kindergartengruppe schätzen. Aber ein seriöser Vergleich erfordert, Vergleichbares zu vergleichen. Ein Vergleich einer guten Familie mit einer guten öffentlichen Betreuungseinrichtung aber hatte noch immer einen eindeutigen Sieger: die Familie. Sie ist durch nichts zu ersetzen.
2. Transferzahlungen oder Erwerbsanreize?
Die Studien zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die an der Ausweitung des weiblichen Erwerbspersonenpotentials orientiert sind, kritisieren allesamt die bisherigen Instrumente der Familienpolitik als „ausgeprägt transferlastig“ (33) und damit als „kontraproduktiv“.(34) Erziehungs- bzw. Elterngeld, Ehegattensplitting und Kinderfreibeträge im Steuerrecht, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehefrauen und Kindern in der Gesetzlichen Krankenversicherung, der Rechtsanspruch auf einen Teilzeitarbeitsplatz und sogar das Kindergeld hemmen die Erwerbstätigkeit der Frauen und vergrößern den zukünftigen Fachkräftemangel. Deshalb wird für die Aufhebung des Ehegattensplittings, die Umlenkung der Transferzahlungen in den Ausbau der staatlichen Kinderbetreuungsinfrastruktur und die Einschränkung von Elternzeit, Mutterschutz und Teilzeitanspruch geworben.(35) Das Kindergeld könne „zur Verbesserung der Betreuungssituation wirkungsvoller eingesetzt werden“.(36) Mit der Ausweitung von Kindertagesstätten, Ganztagskindergärten und Horten würde nicht nur die Erwerbstätigkeit von Müttern gefördert, es würden auch neue Arbeitsplätze für Frauen geschaffen, da in diesen Einrichtungen in der Regel weibliches Betreuungspersonal tätig ist,(37) und so würde auch das Sozialprodukt erhöht.
Manche der Studien hoffen auch noch auf eine Steigerung der Geburtenrate. Selbst der Familienreport der Konrad-Adenauer-Stiftung geht davon aus, dass „der Staat die Kinderzahl weniger durch direkte Transferzahlungen als vielmehr durch Investitionen in Dienstleistungen für Kinder beeinflussen kann“. Er hält es für erwiesen, dass die Frauen in allen westeuropäischen Ländern „heute eher auf Kinder als auf Selbständigkeit und berufliche Entwicklung“ verzichten, und dass „die gleiche Quote der Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Kindern und Männern und eine ausreichende Anzahl qualitativ hochwertiger Betreuungseinrichtungen auch für Kinder unter drei Jahren“ zu den „Indikatoren für eine fortschrittliche Gesellschaft“ zählen.(38) In allen diesen Studien, die nicht nur einzelne Stellschrauben der Familienpolitik, sondern deren Strukturen verändern wollen, kommt das Kind nur als Störenfried vor. Es geht ihnen um die Erhöhung der weiblichen Erwerbsbeteiligung und „um eine für andere Lebensbereiche störungsarme Kinderbetreuung“.(39)
Das verdrängte Kind
Kein Humanvermögen ohne Familie
Die Frage nach dem Wohl des Kindes wird in der Diskussion um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht gestellt. Der Wert der Familie gilt zwar einstweilen noch als unverzichtbar – aber nur für die Reproduktion der Gesellschaft. Ihre Bedeutung für die Sicherung des Humanvermögens bleibt tabu. Wenn in der Vereinbarkeitsdebatte von Humanvermögen oder häufiger noch von Humankapital die Rede ist, dann meist von dem der Mutter, das dem Arbeitsmarkt nicht vorenthalten werden dürfe. Das Humanvermögen der zukünftigen Generation bleibt außerhalb des Blickfeldes.(40) Völlig ausgeblendet bleiben die biologischen, psychologischen und gehirnphysiologischen Bedingungen seiner Entstehung.
Das Humanvermögen ist die Gesamtheit der Daseins- und Sozialkompetenzen des Menschen, die dem Erwerb von beruflichen Fachkompetenzen voraus liegen.(41) Sie werden in der frühen Kindheit in der Familie erworben. Hier werden die Weichen gestellt für die moralischen und emotionalen Orientierungen des Heranwachsenden, für seine Lern- und Leistungsbereitschaft, seine Kommunikations- und Bindungsfähigkeit, seine Zuverlässigkeit und Arbeitsmotivation, seine Konflikt- und Kompromissfähigkeit und seine Bereitschaft zur Gründung einer eigenen Familie, zur Weitergabe des Lebens und zur Übernahme von Verantwortung für andere. Hier wird über den Erfolg im schulischen und beruflichen Erziehungs- und Ausbildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt und in der Bewältigung des Lebens mitentschieden. Nicht nur Wirtschaft und Gesellschaft profitieren von diesen Leistungen der Familie, sondern auch der demokratische Staat, der auf interessierte, motivierte, partizipations- und solidaritätsbereite Bürger angewiesen ist und nicht zuletzt die Kirchen, die für die Weitergabe des Glaubens der Familien bedürfen.
Die entscheidende Phase für die Entstehung dieses Humanvermögens ist die frühe Kindheit. Die Verhaltensbiologie, die Entwicklungspsychologie und die Hirnforschung haben die Bedeutung dieser Phase, die nicht zwingend, aber doch in der Regel an die biologische Familie gebunden ist, die im Ausnahmefall auch von einer Adoptionsfamilie, nie aber von Betreuungseinrichtungen mit Gruppenbetreuung und wechselndem Betreuungspersonal gemeistert werden kann, immer wieder unterstrichen – sowohl positiv im Hinblick auf die Reifung der Persönlichkeit als auch negativ im Hinblick auf das Scheitern einer solchen Reifung als Folge frühkindlicher Betreuungs- und Bindungsmängel. „In der Säuglingszeit bestimmt die langsam entstehende Bindung, in wessen körperlicher Nähe sich das Kind völlig sicher fühlt. Wurde es dem Säugling und Kleinkind durch mehrfachen Verlust von Bezugspersonen oder durch fortdauernde Wechselbetreuung verwehrt, eine feste Vertrauensbindung aufzubauen, so nistet sich allgemeine Unsicherheit und Ängstlichkeit ein. Diese Angst dämpft oder unterdrückt dann den gesamten Verhaltensbereich Erkunden / Spielen / Nachahmen / schöpferisches Erfinden, also das Lernen durch aktiven Erfahrungserwerb und den Gewinn von Selbständigkeit und angstfreiem sozialen Verhalten. Auch die Kleinkindzeit, … so sehr sie … als Entwicklung von Unabhängigkeit und Selbständigkeit zu verstehen ist, lebt somit vom Erhaltenbleiben der gewachsenen Bindungen; der große Aufbruch verkümmert oder scheitert, wenn das Kleinkind keine Geborgenheit findet und keine gesicherte Zuflucht in denjenigen erhaltenbleibenden Bindungen besitzt, in die es schicksalsmäßig hineingewachsen ist … Die grundlegenden Bindungen zu erhalten … ist daher eine humane Aufgabe.“(42) Hassenstein zieht aus diesen Erkenntnissen die in der gegenwärtigen Vereinbarkeitsdebatte hartnäckig ignorierte Konsequenz, dass Familienpolitik vor allem an „Schutz, Stabilisierung, Förderung und Bereicherung des Zusammenhalts und der Lebensgemeinschaft der Familienmitglieder“ orientiert sein muss, und dass sie nie als Instrument der Gesellschaftspolitik missbraucht werden darf.(43) Genau dies aber ist in der Vereinbarkeitsdebatte der Fall.(44)
Was die Verhaltensbiologie, die Psychologie und auch die Kinderheilkunde schon vor mehr als einer Generation wussten und auch verkündeten (45), hat die Hirnforschung in den vergangenen Jahren bestätigt: „Frühe emotionale Erfahrungen werden im Hirn verankert, sichere emotionale Bindungsbeziehungen sind die Voraussetzungen für eine optimale Hirnentwicklung. Störungen stellen für Kinder Belastungen dar, die sie umso weniger bewältigen können, je früher sie auftreten. Sie führen zu einer massiven und lang anhaltenden Aktivierung stressintensiver Regelkreise im kindlichen Gehirn“ (Gerald Hüther). Und auch der Hirnforscher zieht den Schluss: „Daraus müsste sich dringend eine Stärkung elterlicher Erziehungskompetenz ergeben“.(46) Wer die Erkenntnisse der Verhaltensbiologie, der Entwicklungspsychologie, der Kinderheilkunde und der Hirnforschung nicht völlig ignoriert, wer auch noch aufnahmefähig ist für die Kritik an den Ergebnissen der Krippenideologie in den sozialistischen Ländern,(47) kann nur zu dem Ergebnis kommen, dass Kindertagesstätten allenfalls der Notaufnahme von Kindern in Not geratener Mütter, nicht aber der Zwischenlagerung von Störenfrieden berufstätiger Eltern dienen können. Wenn die Bedürfnisse des Kindes und seine Entfaltungsbedingungen nicht völlig verdrängt werden, dann müssen die Bereitschaft und die Fähigkeit der Eltern, das Kind zu erziehen, gestärkt werden, dann darf Familienpolitik nicht zu einem Instrument der Arbeitsmarktpolitik verkümmern. Dies aber ist gegenwärtig der Fall – unter Ursula von der Leyen nicht weniger als unter Renate Schmidt.
2. Bürgerrecht für die Familie
Es kann nicht laut und oft genug gesagt werden: von der Familienpolitik in Deutschland ist eine Umkehr zu verlangen. Will sie den Bedürfnissen und Entfaltungsbedingungen des Kindes um des künftigen Humanvermögens willen gerecht werden, muss sie sowohl die einzelnen Familienmitglieder fördern als auch die Institution Familie schützen. Sie darf sich weder in einer Familienmitgliederpolitik noch in einer Institutionenschutzpolitik erschöpfen.(48) Dazu drei Forderungen:
Erstens: Transferzahlungen sind unersetzbar. Sie sind Investitionen in das Humanvermögen der Gesellschaft, ohne die das Kapitalvermögen verfällt. Sie sind nicht soziale Stütze. Erziehungs- bzw. Elterngeld, Erziehungsurlaub, Berücksichtigung von Ehe und Familie im Steuerrecht und Anrechnung von Erziehungszeiten im Rentenrecht sind deshalb notwendig. Sie werden erst dann der Erziehungsleistung gerecht, wenn sie nicht nur symbolisch sind, sondern in Richtung eines Erziehungsgehaltes weiterentwickelt werden und Erziehung als Beruf anerkennen.(49) Erst dann auch lassen sie der Familie die Freiheit, zwischen einem Familienmanagement – in der Regel durch die Mutter in den ersten drei Lebensjahren eines Kindes – und einer ausserhäuslichen Erwerbstätigkeit zu wählen. Dringend notwendig ist endlich eine Reform der Alterssicherung, die die Kinder in den Generationenvertrag einbezieht und sie sowohl bei den Beiträgen als auch bei den Leistungsansprüchen berücksichtigt, um endlich der Transferausbeutung der Familien ein Ende zu machen.(50) Norbert Glatzel hat dies bereits auf der Sozialethikertagung 1994 gefordert.(51) Kinderfreibeträge im Steuerrecht haben demgegenüber mit Familienpolitik nichts zu tun. Sie sind eine bloße Konsequenz des Gebotes der Steuergerechtigkeit, die gebietet, den Steuerpflichtigen nach dem Maße seiner Belastungsfähigkeit zu belasten und das steuerpflichtige Einkommen um den existenznotwendigen Bedarf zu vermindern.(52) Wenn Kinderfreibeträge schon Familienpolitik wären, könnte die Berücksichtigung eines häuslichen Arbeitszimmers eines Universitätsprofessors auch als Forschungspolitik gelten. Auch die Kinderbetreuungsgutscheine, die in der Vereinbarkeitsdebatte zunehmend vorgeschlagen werden (53) und die Transferzahlungen ersetzen sollen, sind keine familiengerechte Lösung. Sie könnten nur bei einer ausserhäuslichen Erwerbstätigkeit in Anspruch genommen werden und würden die Eltern zwingen, ihre Kinder in einer zwar lizensierten, aber nichtsdestotrotz fremden Betreuungseinrichtung abzuliefern.
Zweitens: Eine familienorientierte Familienpolitik hat den Müttern nach einer kinderbedingten Unterbrechung ihrer Berufstätigkeit zu helfen, wieder in ihren früheren oder einen anderen Beruf einzusteigen. Das wird erleichtert durch eine straffe Ausbildung vor der Erziehungspause wie in Frankreich, wo der Eintritt ins Berufsleben im Alter von 23 oder 24, und nicht wie in Deutschland mit 27 oder 28 erfolgt. Es erfordert aber auch, der Gesellschaft und insbesondere der Wirtschaft Anreize zu vermitteln, Mütter nach der Erziehungspause wieder ins Berufsleben zu integrieren.
Der Katalog der Kriterien für familienfreundliche Betriebe ist lang und die Unternehmen scheinen die Erfüllung dieser Kriterien zunehmend nicht mehr nur als Kostenfaktor, sondern auch als Wettbewerbsvorteil zu verstehen: Teilzeit-arbeitsplätze, flexible Arbeitszeiten, familienfreundliche Urlaubszeiten, Freistellungsmöglichkeiten bei krankheits- oder pflegebedingten Notfällen und Serviceeinrichtungen für Familien gehören zum ABC eines familienfreundlichen Unternehmens. In den 90er Jahren und verstärkt seit 2000 wurde vom Bundesfamilienministerium, von der deutschen Wirtschaft und von der Hertie-Stiftung begonnen, diese Familienfreundlichkeit durch Zertifizierungen (Audit „Beruf und Familie“) und Wettbewerbe zu fördern.(54) Auch die Kontaktpflege zu Mitarbeiterinnen während einer erziehungs- oder pflegebedingten Pause – z.B. durch Einschluss in den Informationsfluss, durch Angebote zur Urlaubsvertretung oder Fortbildung sowie die ganze oder teilweise Berücksichtigung der familienbedingten Unterbrechung bei der Berechnung der betrieblichen Rente – erleichtern die Inanspruchnahme einer Elternzeit und die Wiedereingliederung in einen Erwerbsberuf, mithin die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Über diese eher organisatorischen Maßnahmen hinaus erfordert ein familienfreundliches Unternehmen auch einen Einstellungswandel. Es sollte sich die immerhin schon im Dossier des Instituts der Deutschen Wirtschaft festgehaltene Einsicht verbreiten, dass „Mütter oft mehr zu bieten (haben) als kinderlose Frauen: Die in der Familienphase erworbenen überfachlichen Kompetenzen wie Organisationstalent, Belastbarkeit, Problemlösungs- und Konfliktfähigkeit sowie Verhandlungsgeschick qualifizieren sie für Führungsaufgaben im Betrieb. Verschiedene Studien belegen, dass Mitarbeiter mit Kindern nicht nur belastbarer bei Stress sind, sondern auch teamfähiger, verantwortungsbewusster und gelassener.“(55 )
Drittens: Wer für die Familie das Bürgerrecht fordert, der muss sich der Frage des Familienwahlrechts stellen. Das Recht, in regelmäßigen Abständen die Regierenden bestimmen und dafür unter mehreren Kandidaten auswählen zu können, ist in der Demokratie das Privileg des Bürgers. Dieses Recht muss auch der Familie zuteil werden.(56) Welchem der verschiedenen Modelle eines Familienwahlrechts – Herabsetzung des Wahlalters, Mehrstimmenmodell oder Stellvertretermodell – der Vorzug gegeben wird, ist eine breite öffentliche Debatte wert. Nicht alle Modelle sind mit den Grundsätzen eines demokratischen Rechtsstaates vereinbar. Aber es gibt ein Modell, das mit diesen Grundsätzen kompatibel ist. Auch Kinder und Jugendliche sind Bürger – nicht erst von der Geburt, sondern bereits von der Empfängnis an. Bisher aber ist dieser Teil der Bürger vom Wahlrecht ausgeschlossen. Das Wahlrechtsmodell, mit dem sich die Exklusion vermeiden und auch eine Kollision mit dem rechtsstaatlichen Grundsatz „one man – one vote“ ausschließen lässt, ist ein Kinderwahlrecht, das die Eltern stellvertretend für die Kinder bis zum Erreichen des gesetzlichen Wahlalters wahrnehmen. Das Wahlrecht steht dem Kind als Staatsbürger zu, aber die Eltern nehmen es treuhänderisch wahr, wie sie ja auch andere Rechte des Kindes z.B. auf Ausbildung treuhänderisch für das Kind regeln. Das Wahlrecht wäre also nicht „an eine Eigenschaft gekoppelt“, der bald andere Eigenschaften wie Bildungsstand oder Einkommen folgen könnten, wie Familienministerin Ursula von der Leyen fürchtet.(57) Kinder sind keine Eigenschaften, sondern Personen und deshalb Bürger. Eine Restaurierung des preußischen Dreiklassenwahlrechts oder des britischen Professorenwahlrechts wäre nicht zu befürchten. Ein solches Familienwahlrecht würde der Verantwortung der Eltern für die Kinder entsprechen, den Status der Familie in den vergreisenden westlichen Gesellschaften aufwerten und die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft verbessern. Es würde, selbst wenn es ein individuelles Recht der einzelnen Familienmitglieder bliebe, den Bürgerrechtsstatus der Familie stärken.
Anmerkungen
1Vgl. Herwig Birg, Die demographische Zeitenwende. Der Bevölkerungsrückgang in Deutschland und Europa, München 2001; ders., Die ausgefallene Generation. Was die Demographie über unsere Zukunft sagt, München 2005; Stephan Baier, Kinderlos. Europa in der demographischen Falle, Aachen 2004; Franz-Xaver Kaufmann, Schrumpfende Gesellschaft. Vom Bevölkerungsrückgang und seinen Folgen, Frankfurt 2005; Frank Schirrmacher, Das Methusalem-Komplott, München 2004; ders., Minimum, München 2006.
2 Vgl. die Titelgeschichte des Spiegel vom 6.3.2006 „Unter Wölfen“; die Bild-Zeitung vom 16.3.2006 „Weniger Rente für Kinderlose“; die Wirtschaftswoche „Schneller abwärts“ vom 27.3.2006 und die Serie der Neuen Osnabrücker Zeitung zur Familie im März und April 2006.
3 Vgl. den auf eine Ringvorlesung der Hochschule Vechta zurückgehenden Band von Hermann von Laer und Wilfried Kürschner, Hrsg., Die Wiederentdeckung der Familie, Münster 2004.
4 Vgl. u.a. den Familienreport 2005 der Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin 2006; die von der Bertelsmann-Stiftung herausgegebene Studie von Werner Eichhorst und Eric Thode, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Benchmarking Deutschland aktuell, Gütersloh 2002, die Untersuchung des Instituts für Demoskopie, Einflussfaktoren auf die Geburtenrate, Allensbach 2004, das vom Institut der Deutschen Wirtschaft herausgegebene Dossier 25, Beruf und Familie, Köln 2004; die von Joachim Lange herausgegebenen Loccumer Protokolle 56/02, Kinder und Karriere. Sozial- und steuerpolitische Wege zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Rehburg-Loccum 2003 und weitere einschlägige Publikationen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit und des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
5 Familien und Familienpolitik im geeinten Deutschland. Fünfter Familienbericht, hrsg. vom Bundesministerium für Familie und Senioren, Bonn 1994, Bundestagsdrucksache 12/7560, S. 28.
6 H. Birg, Die ausgefallene Generation, a.a.O., S. 149f.
7 Johannes Paul II., Laborem Exercens 9.
8 Vgl. Christian Leipert, Hrsg., Familie als Beruf. Arbeitsfeld der Zukunft, Opladen 2001.
9 Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Familienreport 2005, a.a.O., S. 36f.
10 A.a.O., S. 35f.
11 Jacques Bichot, Die Familienpolitik in Frankreich, in: Christian Leipert, Hrsg., Aufwertung der Erziehungsarbeit. Europäische Perspektiven einer Strukturreform der Familien- und Gesellschaftspolitik, Opladen 1999, S. 23ff.
12 KAS-Familienreport 2005, a.a.O., S. 42ff.
13 Institut für Demoskopie, Einflussfaktoren auf die Geburtenrate. Ergebnisse einer Repräsentativbefragung der 18- bis 44-jährigen Bevölkerung, Allensbach 2004, S. 24 (Tabelle 9) und 76.
14 A.a.O., S. 81.
15 Niedersachsens Kultusminister Busemann (CDU) hat gerade das Thema Familie, das bisher obligatorischer Teil des Faches Politik war, gestrichen und das Fach in „Wirtschaft und Politik“ umbenannt.
16 Institut für Demoskopie, Einflussfaktoren auf die Geburtenrate, a.a.O., S. 6.
17 H. Birg, Die ausgefallene Generation, a.a.O., S. 33
18 Institut für Demoskopie, Einflussfaktoren auf die Geburtenrate, a.a.O., S. 79.
19 Vgl. Kirche und Abtreibung in Deutschland. Ursachen und Verlauf eines Konflikts, Paderborn 2000, S. 28ff.
20 Die Warnung vor den eigenen Zahlen unterblieb ab 2001, obwohl sich weder die Rechtsgrundlagen der Abtreibungsstatistik noch die Meldeverfahren geändert haben. Vermutlich war es der rot-grünen Bundesregierung inopportun, den eigenen Zahlen mit derartigem Misstrauen zu begegnen.
21 Zu den Problemen der Abtreibungsstatistik vgl. M. Spieker, Kirche und Abtreibung in Deutschland., a.a.O., S. 52ff. und ders., Der verleugnete Rechtsstaat. Anmerkungen zur Kultur des Todes in Europa, Paderborn 2005, S. 17ff.
22 Eine Ausnahme ist das familienpolitische Papier der grünen Bundestagsfraktion „Kinder in den Mittelpunkt. Leben und Arbeiten mit Kindern“ vom 14.2.2006.
23 W. Eichhorst/E. Thode, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, a.a.O., S. 9; Beruf und Familie, IW-Dossier 25, a.a.O., S. 9.
24 Joachim Lange, Sozial- und Steuerpolitik: Hindernisse für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Ansätze ihrer Überwindung, in: Ders., Hrsg., Kinder und Karriere. Sozial- und steuerpolitische Wege zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Rehburg-Loccum 2003, S. 9. Vgl. auch Katharina Spieß, Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Fakten, Mängel und Reformen, in: Sozialer Fortschritt 1/2003, S. 20.
25 Gerhard Engelbrech, Paradoxien der Familienförderung, in: J. Lange, Hrsg., Kinder und Karriere, a.a.O., S. 112.
26 A.a.O., S. 103.
27 Ursula Rust, Schutz oder Falle? Elternzeit, Mutterschutz, Teilzeit, in: J. Lange, Hrsg., Kinder und Karriere, a.a.O., S. 185; A. Lans Bovenberg, Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Lösungen für die gesamte Lebenszeit, in: ifo-Schnelldienst, 57. Jg. (2001), S. 27.
28 Heinz Lampert, Über die Problematik und den Stellenwert der Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, Eichstätter Universitätsreden 115, Wolnzach 2006, S. 13. Auch Lampert kritisiert die arbeitsmarktpolitische Instrumentalisierung der Familienpolitik
29 G. Engelbrech, a.a.O., S. 109.
30 W. Eichhorst/E. Thode, a.a.O., S. 51.
31 Johannes Meier, Den Teufelskreis durchbrechen. Thesen zur Familienpolitik im demographischen Wandel, in: Forum. Das Magazin der Bertelsmann-Stiftung 1/2006, S.19. Meier ist Vorstandsmitglied der Stiftung.
32 So ganz unkritisch der Familienreport 2005 der Konrad-Adenauer-Stiftung, a.a.O., S. 83ff.
33 W. Eichhorst/E. Thode, a.a.O., S. 40. Vgl. auch das familienpolitische Papier der Bundestagsfraktion der Bündnisgrünen, a.a.O., S. 3.
34 G. Engelbrech, a.a.O., S. 203.
35 W. Eichhorst/E. Thode, a.a.O., S. 6f.; Franziska Vollmer, Familienbesteuerung und Berufstätigkeit im Fokus: Steuerliche Belastung berufstätiger Mütter, in: J. Lange, Hrsg., Kinder und Karriere, a.a.O., S. 147ff.; Ursula Rust, Schutz oder Falle? Elternzeit, Mutterschutz, Teilzeit, ebd., S. 171ff.
36 G. Engelbrech, a.a.O., S. 105. Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) hat sich am 21.3.2006 dieser Ansicht angeschlossen und eine öffentliche Debatte ausgelöst mit der Bemerkung „Ich vermute mal, dass ich mit einer Kürzung des Kindergeldes von 4 bis 6 Euro eine Menge Geld zusammenkriegen könnte, um die Gebührenfreiheit von Kindergärten… zu organisieren“. Nachdem sich auch in der SPD Widerspruch regte, stellte Steinbrücks Pressesprecher die Bemerkung als Beitrag zu einer „Wertedebatte“ dar. Vgl. FAZ vom 23.3.2006.
37 W. Eichhorst/E. Thode, a.a.O., S. 10.
38 KAS-Familienreport 2005, a.a.O., S. 25f.
39 G. Engelbrech, a.a.O., S 107.
40 Ausnahme: A. Lans Bovenberg, a.a.O., S. 19.
41 Ein weiteres, alle biologischen, materiellen, anthropologischen und moralischen Leistungen der Familie einschließendes Konzept von Humanvermögen vertritt Eberhard Schockenhoff, Die Familie als Ort sozialen und moralischen Lernens. Moraltheologische Überlegungen zu ihren anthropologischen Grundlagen, in: Nils Goldschmidt, u.a., Hrsg., Die Zukunft der Familie und deren Gefährdungen, Festschrift für Norbert Glatzel, Münster 2002, S. 27f.
42 Bernhard Hassenstein, Die Bedeutung der Familie für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, in: José M. Fontes/B. Hassenstein u.a., Familie – Feindbild und Leitbild, Köln 1977, S. 70f. Vgl. auch ders., Verhaltensbiologie des Kindes, 4. Aufl., München 1987, S. 548ff.
43 B. Hassenstein, Die Bedeutung der Familie, a.a.O., S. 72.
44 Vgl. auch den eine lebhafte Leserbriefdebatte auslösenden Leitartikel von Stefan Dietrich, Unter falscher Flagge, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 31.1.2006.
45 Vgl. von den zahlreichen Publikationen der Kinderpsychotherapeutin Christa Meves, nur Erziehen lernen. Was Eltern und Erzieher wissen sollten, 2. Aufl., Gräfelfing 2000. Aus psychologischer Sicht auch Klaus A. Schneewind, Kleine Kinder in Deutschland: Was sie und ihre Eltern brauchen, in: Arist von Schlippe u.a., Hrsg., Frühkindliche Lebenswelten und Erziehungsberatung. Die Chancen des Anfangs, Münster 2001, S. 124ff. (insbesondere 131ff.) und Steve Biddulph, Wer erzieht Ihr Kind? Kinderbetreuung – eine wichtige Entscheidung, München 2005, S. 117ff. Aus medizinischer Sicht Theodor Hellbrügge, Das sollten Eltern heute wissen. Über den Umgang mit unseren Kindern, München 1975
46 Gerald Hüther, Hirnforschung: Zuwendung ist der wichtigste Erzieher, in: Christa Meves, Verführt. Manipuliert. Pervertiert. Die Gesellschaft in der Falle modischer Irrlehren, Gräfelfing 2003, S. 18. Vgl. auch G. Hüther, Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, Göttingen 2001, S. 69ff. und Christa Meves, Geheimnis Gehirn. Warum Kollektiverziehung und andere Unnatürlichkeiten für Kleinkinder schädlich sind, Gräfelfing 2005.
47 Hans-Joachim Maaz, Der Lilith-Komplex. Die dunklen Seiten der Mütterlichkeit, München 2003, S. 148ff. spricht vom „Kinderkrippentrauma“. Vgl. auch Michail Gorbatschow, Perestroika. Eine neue Politik für Europa und die Welt, München 1987, S. 147 („Wir haben es versäumt, den besonderen Rechten und Bedürfnissen der Frauen, die mit ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau und ihrer unerlässlichen erzieherischen Funktion zusammenhängen, genügend Beachtung zu schenken“)
48 Max Wingen, Familienpolitik, in: Staatlexikon, 7. Aufl., Bd. 2 (1986), Sp. 534. Vgl. auch Mary Ann Glendon, Family Law and Family Policies in a time of turbulence, Family Policies Congress des Social Trends Institute am 27.4.2004 in Rom, Manuskriptband S. 29ff. und M. Spieker, Bürgerrecht für die Familie. Voraussetzungen und Leitlinien einer subsidiären Familienpolitik, in: ders., Der verleugnete Rechtsstaat, a.a.O, S. 129ff.
49 Vgl. auch das vom Päpstlichen Rat Justitia et Pax herausgegebene Kompendium der Soziallehre der Kirche, Freiburg 2006, Ziffer 251 und Janne Haaland Matlary, Frauen zwischen Familie und ausserhäuslicher Erwerbsarbeit, in: Christian Leipert, Hrsg., Familie als Beruf, a.a.O., S. 53ff.
50 Vgl. Hans-Werner Sinn, Führt die Kinderrente ein, in: FAZ vom 8.6.2005; Jürgen Borchert, Renten vor dem Absturz. Ist der Sozialstaat am Ende? Frankfurt 1993, S. 118ff.; H. von Laer, Ausgebeutet und ins Abseits gedrängt: Zur ökonomischen Lage der Familie in Deutschland, in: ders./W. Kürschner, Hrsg., Die Wiederentdeckung der Familie, a.a.O., S. 111ff.
51 Norbert Glatzel, Der Einfluß der Arbeitswelt und der sozialen Sicherungssysteme auf die Familie, in: Anton Rauscher, Hrsg., Welche Zukunft hat die Familie?, Köln 1995, S.80.
52 H. Lampert, a.a.O., S. 134f.; Paul Kirchhof, Ehe und Familie als Voraussetzung für die Überlebensfähigkeit unserer Gesellschaft, Köln 2003, S. 17f.; Rainer Beckmann, Kinder, Familie, Bevölkerung – rechtlich betrachtet, in: Zeitschrift für Lebensrecht, 15. Jg. (2006), S. 8.
53 W. Eichhorst/E. Thode, a.a.O., S. 51; Katharina Spieß, Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Fakten, Mängel und Reformen, in: Sozialer Fortschritt 1/2003, S. 21.
54 Beruf und Familie, IW-Dossier 25, a.a.O., S 31. Vgl. auch die Befragung deutscher Unternehmen, Wie familienfreundlich ist die deutsche Wirtschaft, in: iw-trends 4/2003, S. 7ff.
55 Beruf und Familie, IW-Dossier 25, a.a.O., S. 26.
56 Vgl. Lore Maria Peschel-Gutzeit, Das Wahlrecht von Geburt an: Ein Plädoyer für den Erhalt unserer Demokratie, und Winfried Steffani, Wahlrecht von Geburt an als Demokratiegebot?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 30. Jg. (1999), S. 556ff.; Konrad Löw, Haben wir schon ein allgemeines Wahlrecht?, in: Allgemeines Wahlrecht e. V., Hrsg., Haben wir schon ein allgemeines Wahlrecht? Ein aktuelles Petitum in der Diskussion, Freising 2001, S. 51ff.; Ursula Nothelle-Wildfeuer, Das Kind als Staatsbürger. Wahlrecht gegen die strukturelle Benachteiligung von Familien?, in: Herder-Korrespondenz, 58. Jg. (2004), S. 198ff.
57 Ursula von der Leyen, Interview mit der Tagespost vom 25.2.2006.
Vortrag bei der Sozialethikertagung am 28. April 2006
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Dienstag 13. Juni 2006 um 12:26 und abgelegt unter Ehe u. Familie.