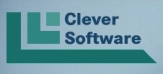Welche Wege führen nach Rom?
Montag 12. März 2007 von Prof. Dr. Athina Lexutt

Welche Wege führen nach Rom? Reformatorische Ein– und Aussichten zwischen Kontroverstheologie und Ökumene
1. TomTom, MartinMartin und BenediktBenedikt
Wahrscheinlich kennen die meisten von Ihnen diese nützlichen, kleinen Helfer. Sie drücken einfach ein paar Tasten – und schon lullt sie eine angenehme Frauenstimme ein und nimmt Ihnen fast alle Sorgen ab: „In 400 m biegen Sie rechts ab; biegen Sie jetzt rechts ab. Abfahrt rechts vor Ihnen. Sie haben Ihr Ziel erreicht.“ Genau. Ich rede von diesen wunderbaren Navigationssystemen, die einen nahezu unfehlbar von Ort A nach Ort B leiten, und mit denen es eigentlich nur dann Schwierigkeiten gibt, wenn man am Anfang irgendeinen Tippfehler bei der Zielorteingabe gemacht hat. Die Frage nach dem rechten Weg wird einem heute also bestens und erfolgreich beantwortet.
Sie ahnen es schon. Ich habe durchaus vor, das Bild des Navigationssystems schamlos auszuschlachten, das Stichwort des „rechten Weges“ aufzunehmen und für diese Tagung ins Theologisch-Ökumenische zu fragen: Was würde uns die freundliche Frauenstimme aus TomTom & Co. wohl ansagen, wenn wir nach dem Weg fragten, der uns nach Rom führt? Gewiß: Viele Wege führen nach Rom. Aber gibt es einen richtigen? Und wollen wir, wenn wir nach Ökumene fragen, überhaupt nach Rom? Oder sollte Rom sich besser auf den Weg nach Wittenberg machen? Und was würde Frau TomTom dann aus dem Minilautsprecher flöten? Oder gilt es gar, das Navi Alternativrouten suchen zu lassen, um Staus und ewig nicht enden wollende Baustellen zu vermeiden?
Meine folgenden Betrachtungen wollen also nach Chancen und Grenzen ökumenischer Bemühungen fragen, die ernsthaft nach dem Gemeinsamen suchen und nach Sichtbarmachung dieses Gemeinsamen, dabei aber sowohl das römisch-katholische als auch das lutherische Profil respektieren. Ich möchte ein bisschen TomTom spielen und dabei MartinMartin einerseits und BenediktBenedikt andererseits in ein fruchtbares Gespräch bringen. Dabei gilt es zu beachten: Ich bekenne, ich tue das als Kirchenhistorikerin mit einem leidenschaftlichen Interesse für Luther und die Reformation und für den römischen Katholizismus. Das hat mindestens drei Konsequenzen: Erstens werde ich zunächst meinen Blick zurücklenken ins 16. Jahrhundert, also mitten hinein in die Hochzeit der kontroverstheologischen Auseinandersetzung; ich werde Martin Luther ausführlich zu Wort kommen lassen im vollen Wissen um die historische Bedingtheit mancher seiner Aussagen und im vollen Wissen darum, daß er zuweilen sehr pointiert die Dinge ins Wort gebracht hat. Zweitens werde ich danach meinen Blick als gute Kirchenhistorikerin, die zuallererst Theologin ist, nicht im 16. Jahrhundert belassen. Ich werde nach vorne schauen in die ökumenische Gegenwart und eine mögliche ökumenische Zukunft. Ich will – im Sinne und als Fortsetzung des Referates von gestern Abend – reformatorisches Gedankengut vergegenwärtigen und von den Spitzenaussagen her fragen, was dies für die ökumenische Perspektive heute bedeutet. Und die dritte Konsequenz aus meinem Bekenntnis: Wer auf die Idee kommen sollte, daß der folgende Vortrag in eine Katholikenschelte ausarten wird – denn schließlich sieht es doch so aus, als würde Rom es sein, das ständig Stolpersteine in den ökumenischen Weg legen würde und als wären es die Kirchenoberen dort, die sich mittelalterlich und voraufklärerisch gebärdeten –, den muß ich arg enttäuschen. Genau das werde ich nicht tun. Und zwar nicht nur, weil sich das nicht ziemte, zumal ohne römisch-katholischen Gesprächspartner, der sich wehren könnte. Sondern weil es ökumenischen Leichtsinn, konfessionellen Starrsinn und theologischen Unsinn auf beiden Seiten gibt. So richtet sich das Folgende an Protestanten ebenso wie an Katholiken. Luther – hätte er heute zu tun – würde sicherlich auch an diejenigen die eine oder andere scharfe Frage richten, die behaupten, auf seinen Schultern zu stehen.
Also: Nachdem wir diese Grunddaten eingegeben haben, schalten wir TomTom doch einfach mal ein.
2. Reformatorische Einsichten und Aussichten
im Gespräch mit Rom
2.1 Voraussetzungen
Kollege Bayer hat gestern Abend ja schon wichtige Elemente benannt, welche die Reformation und ihre Erkenntnisse auch heute noch als überaus aktuell erscheinen lassen, ja vielmehr noch: die als aktuell wahrzunehmen und in christliche Lehre und christliches Leben umzusetzen heilsnotwendig ist. Und zwar nicht, weil die Erben der Reformation einen neuen Heiligenkult um Luther & Co. herum installiert haben, sondern weil sich die reformatorische Erkenntnis und daraus resultierende Predigt und Lehre als Zeugnis der Offenbarung Gottes in den Schriften Alten und Neuen Testaments versteht. Daß „evangelisch sein“ in einem fundamentalen Sinne eine Frage von existenzieller Bedeutung ist, erschließt sich samt den von Kollege Bayer vorgestellten Konsequenzen schon bei einem Blick ins das Reformationszeitalter und seinem Ringen um Wahrheit, erst recht bei einer Betrachtung des Ringens Martin Luthers um ein rechtes Gottesverhältnis und schließlich in der Geschichte immer wieder dann, wenn gerungen wird um das rechte Verständnis des Wortes Gottes. Es sollte also – das ist die zentrale Folge daraus und die unabdingbare Voraussetzung für alles Weitere – beim Gespräch zwischen Rom und Wittenberg, zwischen Römischem Katholizismus und Protestantismus immer um dieses Wort gehen. Nicht um konfessionellen Eigensinn, nicht um Tradition der Tradition wegen, schon gar nicht um Macht und Machterhaltung. Ich überlasse es Ihrer eigenen Beurteilung, wie weit das in den letzten Jahrzehnten wirklich erfüllt wurde – und zwar auf beiden Seiten. Ebensowenig aber darf dieses Gespräch bestimmt sein von einem diffusen „Wir haben uns doch alle lieb“. Wer dem Anderen überhaupt nicht auf die Füße treten will, muß ihm notwendigerweise total aus dem Weg gehen und nimmt dabei weder sich noch diesen Anderen wirklich wahr und ernst. Wenn man beobachtet, wie gefährlich naiv oftmals in Gemeinden das Etikett „Ökumene“ auf vieles geklebt wird und allen ein supertolles Gefühl gibt, aber die Sache verrät, dann darf man schon mal ernsthaft auch danach fragen, was eigentlich so alles in Schulen, vor allem aber in Universitäten an konfessionellen Kernfragen überhaupt noch behandelt wird. Es erscheint angesichts drängender Fragen beinahe als Luxus, auf die zentralen Punkte etwa der Rechtfertigungs– oder der Abendmahlslehre zu drängen. Wer wagt es angesichts der Probleme, die der weltweite Klimawandel mit sich bringen wird, intensiv über „Erbsünde“ nachzudenken? Wer beruft eine Konferenz zu „Amt und Ordination“ ein, wenn irgendwo auf der Welt wieder einmal Menschen unter einem Krieg zu leiden haben? Wer will noch biblische Geschichten erzählen, wenn die Kinder erst einmal dringend Nachhilfe in Schreiben und Lesen brauchen? Und wer hat die Stirn, auf konfessionelle Unterschiede zu pochen, wenn das interreligiöse Gespräch als große Aufgabe bevorsteht, um Terror und Gewalt zu verhindern?
Schickt man indes voraus, daß es um genau all dieser Fragen willen notwendig ist, dann wird schnell klar, wie wenig es sich beim Stellen der genannten Fragen um einen Luxus handelt, wie wenig dabei die scheinbar drängenderen Fragen aus dem Blick geraten. Vielmehr kommt man erst auch in diesen Fragen wirklich zu einer Lösung, wenn man sich vom Wort Gottes getragen weiß, das in bestimmter und nicht in beliebiger Weise bekannt sein will. Kurz gesagt: Ethische Fragen lassen sich nur beantworten, wenn man von einem gewissen, also in Gewissheit geglaubten Fundament zu einem theologischen Urteil zu gelangen sucht. Wenn das GPS-Signal den Ausgangsort nicht finden kann, dann wird die freundliche TomTom-Dame einen auch nicht zum angegebenen Zielpunkt leiten können.
Dies vorausgeschickt setze ich nun den Ausgangspunkt „Martin Luther und seine reformatorischen Einsichten“.
2.2 MartinMartin:
Martin Luther und seine reformatorischen Einsichten
Damit ich von GPS gefunden werden kann, bedarf es nun der inhaltlichen Füllung dessen, was bis jetzt als „evangelisch“ bezeichnet wurde und vollmundig als Frage von existenzieller Bedeutung. TomTom braucht einen Ort, eine Straße und eine Hausnummer. Drei Merkmale also, die zusammen einen eindeutigen und unverkennbaren Ausgangspunkt markieren. Um diese Merkmale herauszuschälen, gehe ich an verschiedenen, zentralen Texten Luthers entlang, die zugleich den gesamten reifen Luther repräsentieren. Wenn Sie – mit Recht! – weitere, nicht minder zentrale Texte vermissen oder sich hier und da eine ausführlichere Darstellung wünschen, dann sei noch erwähnt, daß ich TomTom den Hinweis „schnellste Route“ eingegeben habe und wir ja in der Diskussion noch Zeit haben, das ein oder andere nachzuliefern.
2.2.1 Der Ort: Die drei reformatorischen Hauptschriften von 1520
Mitten in einer Situation, in der ihm eigentlich das Wasser bis zum Hals stand, schrieb Luther – so will ich das mal etwas pathetisch nennen – das Grundsatzprogramm der Reformation. Das ist, von den Inhalten mal ganz abgesehen, bemerkenswert genug. Den Bann klar vor Augen gestellt, läßt Luther sich nicht einschüchtern; er schreibt im Gegenteil so, daß es ihn Kopf und Kragen kosten kann. Er schreibt so Fundamentales, daß die drei Schriften des Jahres 1520 zur Pflichtlektüre jedes Theologen und jeder Theologin gehören sollten. In Abgrenzung gegen die traditionelle Theologie schärft er hier das reformatorische Profil, so daß die Texte ganz besonders aufmerksam im Blick auf unsere Ausgangsfrage zu betrachten und zu befragen sind.
In der ersten der drei Schriften, in „An den christlichen Adel deutscher Nation“, tritt Luther seinen Feldzug gegen die – wie er sie nennt – drei Mauern an, die das Papsttum und die römische Kirche im Laufe der Jahrhunderte um sich gezogen haben. Erste Mauer: die Behauptung, nichts und niemand könne ihnen ernsthaft ans Leder, schon gar nicht weltliche Gewalt, die ja weit unter ihr anzusiedeln sei; zweite Mauer: die Schrift können nur sie recht auslegen, mithin sei jedes gegen sie vorgebrachte und biblisch begründete Argument eigentlich gar keines und allenfalls in sehr ungesunder Weise zurückschlagend; und dritte Mauer: da nur der Papst ein Konzil einberufen kann, ist auch darin keine Instanz zu sehen, die Rom ernsthaft gefährden könne. Luther karikiert Rom und das Papsttum als uneinnehmbare Festung Goliath, der er, David Luther, furchtlos und fest im Glauben mit einer Steinschleuder entgegentritt. Indes wie er das tut, das ist schon grandios. Denn seine Antwort auf diese drei Mauern ist so simpel wie überzeugend: der Papst ist auch nur ein Mensch. Er irrt wie ein Mensch, er steht vor Gott wie ein Mensch, er lebt als Mensch unter anderen Menschen. Wie Luther dies aus der Schrift begründet, ist so wichtig und so mitreißend, daß ich es einfach zitieren muß: „[A]lle Christen sind wahrhaftig geistlichen Standes und ist unter ihnen kein Unterschied auer allein des Amtes halber … Drum ist des Bischofs Weihe nichts anderes, als wenn er an Stelle und Person der ganzen Versammlung nähme – die alle gleiche Gewalt haben – und ihm beföhle, diese Gewalt für die anderen auszurichten. … Daher kommt, daß in der Not ein jeglicher taufen und absolvieren kann, was nicht möglich wäre, wenn wir nicht alle Priester wären. … Denn [und dieser Satz gehört zum Eindrücklichsten, was Luther geschrieben hat] was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, daß er schon zum Priester, Bischof und Papst geweihet sei, obwohl es nicht einem jeglichen ziemt, solch Amt auszuüben.“ (1) Diese Aussage wurde später mit dem berühmt-berüchtigten Schlagwort des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen pointiert. Was daraus in der Geschichte des Protestantismus geworden ist, wollen wir vielleicht lieber mit dem Mantel des höflichen Schweigens bedecken. Merke: Luther hatte mit Demokratie in unserem Verständnis nichts im Sinne. Und merke ferner: das presbyterial-synodale System kommt dem, was Luther meinte, recht nahe; nicht weniger, aber auch nicht mehr; denn statt einem Kirchenfürsten zwölf zu haben, verbessert die Sache nicht wirklich. Was Luther zum Ausdruck bringen wollte, das indes ist in der Tat programmatisch: Die Schrift macht keinen Klerus und Laien, sondern sie macht nur Priester. Wer immer – wunderbares Bild – aus der Taufe gekrochen kommt (nicht etwa stolz erhobenen Hauptes: Seht mal, das bin ich, ein frisch gebackener Christ!), der ist durch die Taufe geistlichen Standes.
Und da also jeder geistlichen Standes ist, steht die Auslegungsfähigkeit auch nicht beim Papst und den Seinen, sondern bei jedem Christen. Wohlgemerkt: die Auslegungsfähigkeit. Die Auslegungsautorität liegt in der Schrift selbst, wie Luther nur wenig später in der „Assertio omnium articulorum“ pointieren wird. Dort wird noch einmal eindrücklich jede menschliche Auslegungsleistung in die Schranken der Irrtumsfähigkeit gewiesen. Mehr noch aber werden an dieser Stelle Subjekt und Objekt der Auslegung in bisher nicht gekannter Weise vertauscht: Ausleger ist die Schrift – nicht der Mensch; und ausgelegt wird der Mensch – nicht die Schrift. Die Schrift prüft, richtet und erleuchtet und legt darin den Menschen aus. Dabei ist das Ziel dieser speziellen Exegese der Glaube dessen, der sich mit der Schrift beschäftigt. Das verdeutlicht, wie wenig es beim „Schriftprinzip“ um irgendein formales principium geht, sondern wie viel mehr um eine inhaltliche, eine materiale Bestimmung, was „Schrift“ ist und warum „Schrift“ diesen Anspruch erheben kann, unum et primum principium (2) zu sein. „Schrift“ meint demnach nicht etwas rein literarisch Faßbares, sondern den in Buchstaben begegnenden Geist (3), das zur Schrift gewordene, lebendige und lebendig machende Wort Gottes, das als Gesetz und Evangelium den Menschen trifft. Und der Anspruch, erstes Prinzip der Christen zu sein (4), steht der Schrift eben deshalb zu, weil sie als Gottes Geschöpf nicht nur historische Erzählung, nicht Geschichte ist, sondern ihr Wort Leben schafft und erhält. Das unterscheidet die Heilige Schrift von aller (!) anderen Schrift. Und das markiert nach Luther vor allem den Unterschied zu jeder menschlichen Tradition. Welche Anfragen an uns Protestanten sich daraus an unseren heutigen Umgang mit Schrift und eigener, auch reformatorischer Tradition ergeben, mögen Sie einmal selbst in Ihrem Herzen bewegen. Die neu aufgeflackerte Kreationismusdebatte – ich habe sie in Gießen unmittelbar vor der Tür – sei nur als ein Beispiel genannt, was hier etwa an Aufklärungsarbeit zu leisten ist.
In der zweiten Hauptschrift des Jahres 1520, in „De captivitate ecclesiae“, in der es primär um das Sakramentsverständnis geht, entzieht Luther in einem Zuge der mittelalterlichen Ekklesiologie jedes Recht. Er macht in dieser Schrift unmißverständlich klar, daß ein Sakrament ein Sakrament durch sein Einsetzungswort und sein spezifisches, sichtbares Zeichen ist und daß es nicht durch den Vollzug des geweihten Priesters wirkt, sondern durch sein Verheißungswort. Damit zog Luther der Kirche seiner Zeit den Boden unter den Füßen weg. Mit den Fundamentalkategorien Wort und Zeichen sowie Verheißung und Glaube schaffte Luther ein irreversibles Gegenüber zum traditionellen Verständnis. Das unterschiedene Beieinander der jeweiligen Begriffe ist unaufgebbar. Denn es geht dabei gar nicht in erster Linie um die Frage, was ein Sakrament ist; oder welche Sakramente es gibt; oder gar, wie die Sakramente recht zu gebrauchen sind. Es geht vielmehr und immer wieder um eine rechte Christologie. Wenn Luther in „De captivitate“ formuliert „[I]n diesem Wort [i.e.: dem Stiftungswort Jesu Christi] und sonst in keinem anderen liegt die Kraft, Natur und das ganze Wesen der Messe. Alles andere ist menschlicher Eifer“ (5), dann gibt es kein Vertun: allein Christus und sonst nichts. Die berühmten Exklusivpartikel der Reformation: sola scriptura, sola gratia und sola fide machen überhaupt nur Sinn, wenn sie als hermeneutische, theologische und anthropologische Pointe verstanden werden, die in der Exklusivität des solus Christus ihren Ausgangspunkt haben. Wenn also Luther in De captivitate ein Sakrament so bestimmt, wie er es tut, wenn er indirekt Kirche so definiert, wie er es tut, dann tut er nichts anderes, als diese Exklusivität wiederum nicht zu Formalprinzipien erstarren zu lassen, sondern ihnen ihr unverrückbares Fundament zu geben: Jesus Christus. Ob uns das bei der Feier des Heiligen Abendmahls immer so klar ist? Ob uns klar ist, welche ekklesiologische Spitze darin verborgen ist? Daß etwa Kirche sich nicht in ihrer Sichtbarkeit erschöpft, sondern ecclesia abscondita ist? Und daß Christus allein Haupt der Kirche ist? Und daß das Heil zwar nicht an der Person des Pfarrers oder der Pfarrerin hängt, sie aber dennoch sehr wohl eine besondere Rolle in der Gemeinde spielen?
Luthers dritter Text, „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, ist sicher derjenige, der am nachhaltigsten und breitesten gewirkt hat und am liebsten mißverstanden wurde. In ihr geht es um die Verhältnisbestimmung von Gott und Mensch und den Menschen untereinander. Die prominente Doppelthese zu Beginn „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. [und] Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“ (6) bringt diese Relationen auf den Punkt. Die Doppelthese mit zwei sich scheinbar völlig widersprechenden Aussagen ist kein Auszug aus dem noch zu schreibenden Buch „Willkommen in Absurdistan“. Im Gegenteil beschreibt sie die Realität des Christen aufs trefflichste, der als innerer und geistlicher im Glauben niemandem verantwortlich als seinem Gott und der als äußerer und leiblicher in der Liebe allen seinen Mitmenschen gegenüber verantwortlich ist. Das ist buchstäblich spannend und kann mit nichts verglichen werden, was in der traditionellen Theologie, in Mystik oder Scholastik, nicht einmal in der Theologie der Kirchenväter zu finden ist. Luther ist darin, dem Menschen solche Spannung zuzumuten und sie ihn aushalten zu lassen, für meine Begriffe unerreicht. Das Revolutionäre daran ist, daß alle herkömmlichen Schemata von Gut und Böse, Freier und Sklave, innen und außen usw. usf. aufgebrochen und in den Menschen selbst verlegt werden, der als Sünder und Gerechtfertigter zugleich (und beides ganz und gar) im Glauben nur ein wahres Gegenüber hat: seinen Gott, dem er im Gewissen begegnet. Dies allein befreit ihn aus der Unheilsspirale des Versuchs, sich selbst rechtfertigen zu müssen im aussichtslosen Bemühen, das Gesetz zu erfüllen. Gott sieht nicht die Werke an, sondern die Person. Darin besteht christliche Freiheit, gute Werke um des Nächsten willen tun zu dürfen, nicht um des Heils willen tun zu müssen. Daß gute Werke notwendig sind, daran läßt Luther keinen Zweifel. Aber er weist den Werken ihren Ort zu: Sie geschehen, weil der Mensch gerechtfertigt ist, nicht, damit er gerechtfertigt wird. Das ermöglicht es, die politische und gesellschaftliche Situation und ihre Probleme und Fragen eingehend zu analysieren und zu weiter vorausschauenden ethischen Urteilen und Lösungsansätzen zu gelangen. Ethik aber braucht ein Fundament. Sonst sind diffuses und beliebiges Handeln die Folge.
2.2.2 Die Straße: „De servo arbitrio“ von 1525
und die „Disputatio de homine“ von 1536
Das Jahr 1525 ist für Luther in ähnlicher Weise brisant wie das Jahr 1520. Er gerät durch innerreformatorische Unruhen und namentlich durch die Bauernkriege in die Kritik und auch in Selbstzweifel; er heiratet eine geflüchtete Nonne und gibt damit den römischen Verdächtigungen letzte Nahrung; und er setzt einen Schlußstrich unter sein ohnehin etwas gespanntes Verhältnis zum Humanismus.
Letzteres tut er mit einer seiner dichtesten und tiefsten Schriften, mit „De servo arbitrio“ – „Vom unfreien Willensvermögen“. Dort erweitert und profiliert er das bereits erwähnte Schriftprinzip und macht noch deutlicher als in der Adelsschrift, daß sich in dieser Frage nicht nur das Amtsverständnis entscheidet, sondern das Verständnis von Jesus Christus als Mitte der Schrift. Ja, es wird nun zur unverrückbaren Gewissheit, daß diese Themenkomplexe unlöslich ineinander verzahnt sind. Jede Füllung eines Themas der Ekklesiologie ist eine Konsequenz aus dem christologischen Verständnis. In „De servo arbitrio“ entzieht er aber vor allem der mittelalterlichen Anthropologie – sowohl der scholastischen als auch der mystischen – jede Grundlage, indem er leugnet, es gebe im Menschen irgendeine von der Sünde unberührte Kraft, die den Menschen dazu bringen könne, daß er wolle, Gott sei Gott. Der Mensch kann, so spitzt Luther radikal zu, nur so wollen, wie Gott oder der Satan wollen, die um seinen Besitz kämpfen und ihn als Reittier dorthin treiben, wohin sie ihn haben wollen. Diese Negation des freien Willensvermögens – mit Konsequenzen bis in die Theodizeeproblematik hinein – ist die Spitze des Eisberges „Rechtfertigungsverständnis“. Wer begriffen hat, was es um die Rechtfertigung des Gottlosen ist, der kann schlechterdings kein freies Willenvermögen behaupten.
Was „Rechtfertigung“ bedeutet, muß ich hier hoffentlich nicht eigens erläutern und kann statt dessen zum nächsten Merkmal reformatorischer Einsicht kommen: Diese Erfahrung der Rechtfertigung des Gottlosen ist so fundamental, daß Luther mit Hilfe dieser Formel – ohne daß sie zu einer bloßen Formalisierung erstarrt wäre – den Menschen definieren kann. In der „Disputatio de homine“ aus dem Jahre 1536 schmettert Luther zunächst die philosophische Definition des Menschen ab, der Mensch sei ein vernunftbegabtes, fühlendes Lebewesen. Freilich gelte diese Bestimmung – doch nur in hac vita, in diesem Leben. Der ganze Menschen jedoch sei definiert in dem Satz: homo iustificandus per fidem – der Mensch ist derjenige, der strukturell auf die Rechtfertigung durch Glauben angewiesen ist. Er ist ein Wesen in processu, ein geschichtliches Wesen, und er ist als von Gott Angeredeter dessen Ebenbild und wird darin zur Person. Nicht die Vernunft macht den Menschen zum Menschen – sondern die Anrede Gottes! Erst im iustificandus zeige sich – und das ist der entscheidende Aspekt – der gesamte Mensch und nicht nur ein Teil, wenn dieser Teil auch in der Welt und vor den Menschen sicher der vornehmste ist. Wie hier Luther und auf ihn sich berufende evangelische Theologie alles, wirklich alles weit hinter sich lässt, was Philosophie, Psychologie, Soziologie und wie sie alle heißen über den Menschen aussagen können, kann ich an dieser Stelle nicht einmal andeuten. Nur so viel: Dem Menschen, vor allem, aber nicht ausschließlich dem leidenden und verzweifelten, dem fragenden, dem angefochtenen Menschen wird hier ein Ausweg gezeigt, der seinesgleichen sucht. Diese Definition des Menschen als homo iustificandus, als Lebewesen, das unvermeidlich in einer Relation steht – oder es ist kein Mensch! -, eröffnet dem Menschen Räume und Zeiten, die ihm nichts anderes bieten kann. Diese Definition konstituiert christliche Freiheit.
2.2.3 Die Hausnummer: Die Schmalkaldischen Artikel von 1536
In den Schmalkaldischen Artikeln von 1536 macht Luther unmißverständlich reinen Tisch. Angesichts des ausgeschriebenen Konzils und aufgefordert von seinem Kurfürsten, die zu diskutierenden Themen zu benennen, nähert sich Luther Rom nicht an, sondern markiert im Gegenteil das unüberwindlich Gegensätzliche. Es gibt vier Punkte in der theologischen Lehre, so Luther, an denen es mit Rom, mit der Papstkirche auf ewig zu keiner Übereinstimmung kommen wird: die Lehre vom Abendmahl, die Lehre vom päpstlichen Primat, die Lehre von den Mönchsgelübden – und an erster Stelle und vor allem: in der Lehre von der Rechtfertigung, die bei ihm bereits als solche definiert wird, mit der in der Kirche steht und fällt. Eberhard Jüngel hat den Begriff von der kriteriologischen Funktion der Rechtfertigungslehre geprägt, der genau dies meint: Vom Rechtfertigungsverständnis her erschließt sich die gesamte Theologie. Auch das Verständnis des Amtes in der Kirche, das im 16. Jahrhundert vornehmlich in der Frage nach dem päpstlichen Primatsanspruch besteht. Luther poltert diesbezüglich mit einer Sprache, die keinen Widerspruch duldet, „[d]aß der Papst nicht ‚jure divino‘ oder aus Gottes Wort das Haupt der ganzen Christenheit sei – denn das gehört einem allein zu, der heißt Jesus Christus -, sondern allein Bischof oder Pfarrherr der Kirche zu Rom und derjenigen, die sich freiwillig oder durch menschliche Kreatur – das ist weltliche Obrigkeit – zu ihm begeben haben, um nicht unter ihm als einem Herrn, sondern neben ihm als einem Bruder und Gesellen“. (7) In diesem Zusammenhang wird der Papst einmal mehr als uneinsichtig bezeichnet und daher als Antichrist charakterisiert, dem zu widerstehen sei, was Luther in seinen letzten Lebensjahren dann noch einmal zu einer erbitterten Polemik führen wird.
Luther ist in diesem Text ausgesprochen illusionslos: „auf ewig keine Einigung“ meint bei ihm in der Tat „auf ewig“. Kann man nach diesen reformatorischen Einsichten aus überhaupt noch von „ökumenischen Aussichten“ sprechen?
2.3 BenediktBenedikt: Rom
Unser Navigationssystem ist nun also mit den Daten des Ausgangsortes gefüttert. Wir haben unverrückbare Merkmale protestantischen Profils festgestellt, an die sich weitere anknüpfen ließen; um noch einmal nur die wichtigsten zu nennen: die Rechfertigung des Gottlosen sola fide; die Fundamentalunterscheidungen von Person und Werk sowie von Gebundenheit und Freiheit; die Negation eines feien Willensvermögens und damit verbunden zahlreiche weitere Grundaussagen über Gott und den Menschen; das Schriftprinzip; die Unterscheidung von Stand und Amt; eine Ekklesiologie, die ihre inhaltliche Spitze – wie alle anderen Lehrstücke auch – in einer radikal soteriologisch verstandenen Christologie hat.
Wenn wir danach „Rom“ als Zielort unserer ökumenischen Reise angeben würden, geriete das Navi in arge Schwierigkeiten. Denn Rom kann nach dem bisher Konstatierten unmöglich das zu erreichende Ziel sein. Jedenfalls im 16. Jahrhundert nicht. Aber vielleicht doch heute? Ich darf gleich sagen, daß ich mich des Eindrucks nicht erwehren kann, wie wenig weiter wir heute sind als im 16. Jahrhundert. Und darum bin ich in gewisser Hinsicht froh, denn das könnte ja nicht nur ein Zeichen für einen konfessionellen Dünkel sein, sondern auch dafür, daß es damals schon um eine nicht nebensächliche Sache ging und auch heute noch wirklich um die Sache gerungen wird. Um nun meinen Eindruck zu begründen, will ich einen Blick in das heutige Rom, fast 500 Jahre nach Luther, werfen und überlegen, was sich von Luthers reformatorischen Einsichten her für ökumenische Aussichten ergeben.
Sie gestatten, daß ich dabei gleich auf den neuralgischen Punkt zusteuere: der Papst. Genauer: dieser Papst. Seit Deutschland in einem „Wir-sind-Papst“-Selbstbewußtseinsrausch schwelgt, ist das höchste Amt in der römisch-katholischen Kirche wieder zu einem ausgesprochen deutschen Problem geworden. Alle lieben diesen bescheiden und bestimmt zugleich auftretenden Benedikt, ihn nicht zu lieben, gar kritisch anzufragen scheint unmöglich geworden zu sein, vor allem nach seinem ziemlich sympathischen Auftreten bei seinem Heimatbesuch im letzten Jahr. Ich gestehe es: Auch ich habe begeistert vor dem Fernseher gesessen und hätte ihm einfach mal gerne die Hand gedrückt. Ich hätte allerdings auch gerne ein bißchen mit ihm diskutiert. Denn nur allzu leicht vergisst man, daß Joseph Ratzinger zu den Hardlinern im Vatikan gehörte und wie kaum ein anderer der Ökumene der letzten Jahrzehnte so manchen falschen Wind aus den übermütig geblähten Segeln genommen hat. Ich erinnere nur an „Dominus Iesus“.
Lassen Sie mich zur Illustration des Problems eine Szene schildern: „Worum geht es bei der Wiederherstellung der Einheit aller Christen? Die katholische Kirche erstrebt das Erreichen der vollen sichtbaren Einheit der Jünger Christi, wie sie das Zweite Vatikanische Konzil in verschiedenen Dokumenten definiert hat […]. Diese Einheit besteht nach unserer Überzeugung unverlierbar in der katholischen Kirche.“ (8) Es ist gar nicht lange her, seit sich Benedikt XVI. so geäußert hat, und zwar hochoffiziell in seiner Ansprache beim ökumenischen Treffen mit Vertretern christlicher Kirchen anlässlich des XX. Weltjugendtages in Köln. Im erzbischöflichen Palais hat sich niemand besonders darüber aufgeregt, weil das wohl auch kaum zum guten diplomatischen Ton gehört hätte. Und außerhalb des Palais verschwand diese Äußerung neben dem viel bedeutenderen Besuch der Kölner Synagoge. Hätte es Mahner, Warner und Erinnerer gegeben, so wären sie mit Sicherheit niederskandiert worden von den frenetischen „Benedetto“-Rufen; und selbst denjenigen, die mit einer unbeirrbaren Hermeneutik des Verdachts alles verdächtigen, was je aus Rom verlaut– oder verleisbarte, wäre es bei der samstagabendlichen Vigilfeier viel zu warm ums Herz geworden, um sich noch über irgendetwas aufzuregen. Solange Rom sich so perfekt inszeniert wie beim Sterben des alten und beim Machen des neuen Papstes sowie seitdem immer wieder, besonders beim bereits erwähnten Heimatbesuches Benedikts, und solange die ansonsten kritischen Medien, davon sanft eingelullt, wie selbstverständlich „Kirche“ mit „Rom“ und „Papst“ identifizieren, haben Mahner, Warner und Erinnerer nur eine geringe Chance. Dabei hätte diese Äußerung beim Weltjugendtag durchaus stutzig machen können. Sie verdeutlicht, daß Benedikt XVI. genau wie sein Vorgänger nie einen Zweifel daran gelassen hat, daß er die über Jahrhunderte gewachsene und in Vatikanum I zementierte Vorrangstellung des Römischen Bischofs in keiner Weise in Frage stellen würde. In der römischen Kirche „subsistit“ die wahre Kirche – Ratzinger gehörte zu den Hardliner-Interpreten dieses schwierigen Wortes „subsistit“, und das meint: Rom ist die wahre Kirche. In dieser römischen Kirche ist der Römische Bischof in der Gemeinschaft mit den Bischöfen das unangefochtene Haupt, und dessen Aufgabe versteht Benedikt vor allem als Einheitsamt.
Zweites Beispiel: die inzwischen berühmte Regensburger Vorlesung Benedikts. Sie ist zu einem Aufreger sondergleichen geworden, weil sich muslimische Vertreter von den Äußerungen des Papstes auf den Schlips getreten fühlten. Mal ganz davon abgesehen, daß dieses ganze Spiel eine wunderbare Vorbereitung für Benedikts Türkeibesuch wurde und der römische Papst wieder einmal als Vertreter der und Kämpfer für die gesamte Christenheit erscheinen konnte (wobei diese Absicht natürlich keiner unterstellen würde), und mal ganz davon abgesehen, daß die Rede einfach methodisch schlecht war, weil sie unnötig zwei Themenbereiche miteinander gekoppelt hatte (was natürlich erst recht niemand laut sagen würde) – ganz davon abgesehen hätten protestantische Vertreter durchaus auch beleidigt sein können, daß der Reformation so ganz en passant in die Schuhe geschoben wurde, sie seien in der westlichen Welt für den Abbruch des fruchtbaren Zusammens von Glaube und Vernunft verantwortlich. Das ist eine grobe Verzeichnung des reformatorischen Verständnisses sowohl von Glaube als auch von Vernunft, wie der minimale Einblick etwa in Luthers „Disputatio de homine“ gezeigt haben dürfte. Aber: Kein protestantischer Kirchenfürst sah sich provoziert, an Benedikt zumindest einmal eine kritische Anfrage zu stellen. Woran liegt dieses seltsame Schweigen dem Mann aus Rom gegenüber?
Damit bin ich bei der ersten Schwierigkeit, der großen Spannung, in der ein Gespräch zwischen – Sie erlauben, daß ich auch 500 Jahre die Städtenamen noch als Chiffren für bestimmte Inhalte verwende – „Wittenberg“ und „Rom“ immer wieder befindet. Das Priestertum aller Getauften ist unverzichtbares Gut protestantischer Identität. Und das gilt es im ökumenischen Dialog, der keinem faulen Kompromiß zustrebt, sondern einer echten Lösung, kenntlich zu machen. Genauso wird Rom nicht gut auf sein Verständnis verzichten können, ohne wesentliche Elemente der eigenen Identität wegbrechen zu lassen. Es wäre vermessen, von den Römisch-Katholischen zu erwarten, sie könnten den Papst so mir nichts dir nichts über Bord werfen. Zeichen konfessioneller Rücksicht dagegen wäre es, diesen Fundamentaldissens im Amtsverständnis zu akzeptieren und zu überlegen, was dennoch möglich ist. Zugegeben: Es ist beeindruckend, welche Faszination vom Papstamt ausgeht, und es nicht minder faszinierend, Gläubigen auf der ganzen Welt zuzusehen, wie sie angesichts eines Herrn in Weiß in Verzückung geraten. Der Papst als Medienereignis, der eilige Vater unterwegs auf der ganzen Welt, um Frieden und Versöhnung zu predigen, ein Kirchenoberer, dem diese Welt zuhört beim Gebet – das alles haben wir nicht zu bieten, und es ist bedenklich, wie wenig präsent Kirche überhaupt und evangelische Kirche insbesondere in bundesdeutschen Fernsehanstalten ist – von der Vorzeigebischöfin Margot Käßmann mal abgesehen. In Talkshows werden gerne Vertreter des römischen Katholizismus eingeladen, weil die rein äußerlich leichter als Kirchenvertreter zu erkennen sind, neuerdings ist es der sympathische Abtprimas Notker Wolf im Benediktinergewand, der für alles Ethisch-Moralische herhalten muß. Ich denke, auf diesem Gebiet muß evangelische Kirche viel aktiver und durchaus auch aggressiver werden und sich vom Papst nicht den Schneid abkaufen lassen. Sicher: Wir werden wohl nie so äußerlich hübsche Medienereignisse wie die erwähnte Vigilfeier hinkriegen. Aber ein bißchen mehr davon und hin und wieder ein Versuch, die Bedeutung des Wortes zu visualisieren, kann nichts schaden. Und: Das kann nur funktionieren, wenn der Amtsinhaber völlig hinter seinem Amt zurücktritt. Für unsere Frage nach der Ökumene heißt das also: Das Selbstverständnis des römischen Bischofs gehört zu den vordringlich zu klärenden Fragen, ohne die alles andere in der ökumenischen Beziehung nicht recht funktionieren kann.
Damit sind wir schon mitten in der nächsten Schwierigkeit: dem Kirchenverständnis. Über den Kirchenbegriff ist im Zusammenhang mit jüngeren Äußerungen aus Rom viel nachgedacht worden, und man kann Ratzinger und Co. nur dankbar sein, daß der an dieser Stelle sanft entschlafene Protestantismus aufgerüttelt und zu eben diesem Nachdenken angeregt worden ist. Damit kein falscher Eindruck entsteht: Das ist keineswegs ironisch gemeint. Ich jedenfalls bin immer und sehr dankbar für klare Positionen, an denen man knabbern kann. Die tiefe Einsicht Luthers besagt: Kirche als Leib Christi ist in keiner sichtbaren Kirche verwirklicht. Und doch in jeder Gemeinschaft, in der zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Das ist eine Spannung, die in dem „simul iustus et peccator“, dem „gerecht und Sünder zugleich“ begründet ist und die wir schlicht und ergreifend aushalten müssen. Nachdem wir über das Amtsverständnis als bleibenden Stolperstein im Gespräch mit Rom schon gesprochen haben, ergeben sich daraus nun zwei neue Probleme: Die Frage, was Kirche ist, muß wegen des Selbstanspruchs Roms, einzig wahre Kirche zu sein, mit aller Vehemenz gestellt und beantwortet werden. Das Ökumenismusdekret des 2. Vatikanischen Konzils spricht über andere christliche Gemeinschaften als die römisch-katholische Kirche dezidiert nicht von Kirche oder Kirchen. Das hat sich bis heute gehalten: Benedikt XVI. hat in Begegnungen, in gemeinsame Feiern und bei Reden zu verschiedenen Anlässen keinen Zweifel daran gelassen, daß „katholische Kirche“ für ihn gleich bedeutend ist mit „römisch-katholischer Kirche“. Die eine und wahre und apostolische und heilige Kirche ist die Kirche Roms und sonst keine. Das läßt sich mit dem evangelischen Verständnis nicht vereinbaren und führt zum nächsten Problem: der Verunmöglichung eines gemeinsamen Abendmahls. Wer die ökumenische Diskussion der letzten Jahre verfolgt hat, der weiß, welchen Stellenwert die Frage nach dem Sakrament in der konfessionellen Auseinandersetzung hat. Zu recht, denn daran ist nichts Geringes geknüpft. Gerade aber in der heißen Diskussion um ein ökumenisches Abendmahl – namentlich im Kontext des Ökumenischen Kirchentages – hat sich mitunter eine erschreckende Ignoranz auf evangelischer Seite gezeigt. Und zwar im Blick auf das eigene Abendmahlsverständnis wie auch im Blick auf das römisch-katholische. Konfessionelle Rücksicht gebietet hingegen, die tiefe Bedeutung zu verstehen zu versuchen, die in der katholischen Kirche der Eucharistie beigemessen wird. Das Mysterium der Eucharistie, von Vatikanum II als Richtscheit für wahren Glauben und wahre Kirche definiert, kann nicht einfach ohne Verluste durch ein ökumenisches Abendmahl ersetzt werden. Hier war der Kirchentag nicht nur zu optimistisch, sondern auch zu voreilig und zu leichtsinnig, und ich kann verstehen, daß – ausgerechnet – am Gründonnerstag 2003 eine entsprechende Besinnung zur Eucharistie mit unverhohlener Warnung aus Rom geflattert kam. Die Prämisse selbst der insgesamt sicher progressiver einzuschätzenden deutschen Bischöfe, ihnen voran der Mainzer Kardinal Lehmann, daß es keine Kircheneinheit ohne Lehreinheit gebe, ist nicht nur innerhalb des Systems „römischer Katholizismus“ unverzichtbar. Ob eine eucharistische Gastfreundschaft nicht dennoch möglich wäre, sei einmal dahingestellt. Ich würde sie mir jedenfalls wünschen, halte aber etwa eine evangelisch-römisch-katholische Konzelebration für einen theologischen Gewaltakt, der vermieden werden sollte, ja, um der Sache willen vermeiden werden muß.
Damit bin ich beim eigentlichen Knackpunkt. Luther mahnt eindringlich über den Spalt der Jahrhunderte hinweg, im Blick zu behalten, daß es bei all dem immer um Christus geht. Das ist reformatorische Einsicht einer Theologie, die in den Sakramenten deshalb Kraft und Trost erblickt, weil in ihnen Christus durch sein Wort und Zeichen begegnet, der durch dieses Wort und durch diese Zeichen Kirche schafft, die durch seine Gegenwart heilig und gerecht und durch die Gegenwart der Menschen zugleich sündig ist. Immer also geht es zuerst und zuletzt um Christus. Das klingt so selbstverständlich. Natürlich geht es um Christus. Aber meinen fünf verschiedene Menschen dasselbe, wenn sie „Christus“ sagen? Die ökumenische Diskussion hat immer wieder Glauben gemacht, daß es wenigstens einen Bereich gibt, in dem nicht zu hinterfragende Einigkeit zwischen den Konfessionen besteht: das Gottes- und Christusbild. Das ist gewiß auch richtig hinsichtlich der Tatsache, daß Gott der Schöpfer ist, daß Gott dreieinig ist, daß Christus Gottes Sohn und wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist, daß er gelebt und gewirkt hat, gekreuzigt, gestorben und begraben und auferstanden ist und zur Rechten Gottes sitzt, von wo er zum Gericht wiederkommen wird. Und das ist ja schon mal was. Was sich aber hinter diesen Attributen bzgl. des Heilsgeschehens verbirgt – wenn da ebenfalls Einigkeit bestünde, dann ist es mir schlechterdings schleierhaft, warum immer noch Gegensätze bestehen im Kirchen- und Amtsverständnis, im Rechtfertigungsverständnis, im Sakramentsverständnis. Es ist Luthers Verdienst, diesen unauflöslichen Zusammenhang zwischen Christologie und allen anderen „-logien“ der Theologie benannt und damit Jesus Christus und das Heilsgeschehen, die von dort neu zu bestimmende Relation zwischen Gott und Mensch ins Zentrum der Betrachtung gerückt zu haben. Der Rechtfertigungsartikel kann nur deshalb zum articulus stantis et cadentis ecclesiae werden, weil es in ihm um Christus geht. Mir scheint, daß dieser Zusammenhang nicht mehr recht im Bewußtsein ist. Nicht zuletzt eben deshalb, weil man wahrscheinlich froh ist, im ökumenischen Dialog nicht noch ein Faß aufmachen zu müssen. Mir scheint es aber dringlich geboten, sich davor nicht zu scheuen, denn wenn man es nicht tut, dann ist bzw. wird der Wein in den anderen Fässern faul.
Die kritische Anfrage sei zuerst an den Protestantismus unserer Tage gestellt: Wie ernst ist es uns mit diesem Christus? Bei aller Notwendigkeit, über die überhaupt nicht diskutiert werden oder die in keiner Weise hinterfragt werden darf , bei aller Notwendigkeit des christlich-jüdischen, des christlich-islamischen, überhaupt des interreligiösen Dialogs: Welche Rolle spielt es dabei, daß wir als Christen diesen Christus zu bekennen und zu bezeugen haben? Verstehen wir, was das heißt: sola gratia und sola fide? Wollen wir das überhaupt? Sind wir willens und in der Lage, in den politischen und gesellschaftlichen Diskursen unserer Zeit ausgehend von einer christologischen Basis zu argumentieren? Ist bei uns dieser Christus nicht längst zu einem historisch beschreibbaren, ausgesprochen vorbildhaften Menschen verkommen? Vertrauen wir noch darauf, daß er am Kreuz Erlösung geschaffen hat? Was bedeutet es uns noch, dieses Kreuz, außer daß es ein hübsches Schmuckstück ist? Genauso kritisch muß aber auch an den römischen Katholizismus die Frage gestellt werden, was ihm dieser Christus im Blick auf die Erlösung bedeutet. Damit ist natürlich das weite Feld der Rechtfertigungslehre beschritten. Es ist viel darüber diskutiert worden, ob Protestanten und Katholiken sich über die Frage der Rolle von Gnade, Glaube und gutem Werk nicht viel näher sein, als so verbohrte Dogmatiker behaupten. Dazu kann ich nur kalauernd und leicht karikierend sagen: Wer das denkt, der hat „Pesch“ gehabt. In der Tat werden die Lehre von der Rechtfertigung und von der christlichen Freiheit zum Prüfstein dafür, ob und wie sehr man begriffen hat, was es um Gott, den Menschen, die Sünde und die Erlösung durch Jesus Christus ist. Da reicht es nicht zu vermuten, daß dann, wenn Luther Thomas von Aquin gelesen hätte, das alles nicht passiert wäre. Was Thomas lehrt, ist etwas fundamental anderes als das, was Luther glaubt, aus der Hl. Schrift herauslesen zu können. Die Reformation war kein theologiegeschichtlicher Unfall – das so darzustellen heißt, weder Luther noch Thomas gerecht zu werden. Und wenn man sich die – ja vielleicht auch nicht zufällig ziemlich wirkungslose – Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre anschaut: Wie kann man von Übereinstimmung in Grundwahrheiten sprechen, wenn dann unterschiedliche Konsequenzen daraus gezogen werden? Das ist für mich ein hermeneutisches Unding. Die reformatorische Einsicht in das Wie der Relation Gott-Mensch lässt für ein solches Unding keinen Raum: Entweder es geschieht Rechtfertigung allein aus Glauben durch Christus – oder nicht. Hier ist um der Sache willen kein Kompromiss möglich. Und die konfessionelle Rücksicht muß anerkennen, daß an dieser Stelle der katholische Gesprächspartner um der Sache willen ebensowenig Kompromisse schließen kann. Sein Verständnis vom Menschen, gerade im Blick auf Sünde und freies Willensvermögen, scheint mir deutlich ein anderes zu sein, das mit dem lutherischen schlechterdings nicht kompatibel ist. Um nur ein Beispiel zu nennen: Das viel beachtete und höchst gelobte Grundsatzpapier Benedikts XVI., seine Enzyklika „Deus caritas est“ vom 25.12.2005, beinhaltet in der Tat viel beachtliches und Bedenkenswertes zum Thema „Liebe“ im christlichen Sinne. Auch Christus kommt in diesem Papier vor. Auch. An mindestens zwei Stellen aber wird dem aufmerksamen Leser klar, welche vergleichsweise untergeordnete Rolle Christus spielt – jedenfalls, wenn man einen reformatorischen Maßstab ansetzt. Etwa an folgender Stelle, wo das freie Willensvermögen positiv ins spiel gebracht wird: „Die Erkenntnis des lebendigen Gottes ist Weg zur Liebe, und das Ja unseres Willens zu seinem Willen einigt Verstand, Wille und Gefühl zum ganzheitlichen Akt der Liebe. Dies ist freilich ein Vorgang, der fortwährend unterwegs bleibt: Liebe ist niemals ‚fertig’ und vollendet; sie wandelt sich im Lauf des Lebens, reift und bleibt sich gerade dadurch treu. Idem velle atque idem nolle – dasselbe wollen und dasselbe abweisen – das haben die Alten als eigentlichen Inhalt der Liebe definiert: das Einander-ähnlich-Werden, das zur Gemeinsamkeit des Wollens und des Denkens führt. Die Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch besteht eben darin, diese Willensgemeinschaft in der Gemeinschaft des Denkens und Fühlens wächst und so unser Wollen und Gottes Wille immer mehr ineinanderfallen: der Wille Gottes nicht mehr ein Fremdwille ist für mich, den mir Gebote von außen auferlegen, sondern mein eigener Wille aus der Erfahrung heraus, in der Tat Gott mir innerlicher ist als ich mir selbst.“ Und noch deutlicher an exponierter Stelle, am Schluß, an der kein Gebet zu Jesus, sondern zu Maria zu finden ist: „Heilige Maria, Mutter Gottes, du hast der Welt das wahre Licht geschenkt, Jesus, deinen Sohn – Gottes Sohn. Du hast dich ganz dem Ruf Gottes überantwortet und bist so zum Quell der Güte geworden, die aus ihm strömt. Zeige uns Jesus. Führe uns zu ihm. Lehre uns ihn kennen und ihn lieben, damit auch wir selbst wahrhaft Liebende und Quelle lebendigen Wassers werden können inmitten einer dürstenden Welt.“ Hier schlägt sich eine Sicht nieder, die mit reformatorischem anliegen kaum vereinbar scheint.
3. Schluss
Und jetzt? Jetzt schweigt unser Navigationsgerät auf ewig, die TomTom-Dame völlig verwirrt und ratlos, weil es keinen ökumenischen Weg zu geben scheint, wenn beide Seiten es ernst meinen? Keine Chance für die Ökumene? Da kann ich nur sagen: Weit gefehlt! Allerdings glaube ich nicht, daß wir in absehbarer Zeit eine sichtbar einheitliche Kirche erreichen. Was denn aber dann? Lassen Sie mich dazu abschließend einige knappe Thesen aufstellen, gespeist aus reformatorischer Einsicht und ökumenischer Hoffnung:
1. Klarheit. „Um Gottes willen: Klarheit!“ Dieser Seufzer stammt nicht von mir. Eberhard Jüngel hat ihn getan im Kontext der Debatten um die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Und recht hat er! Es kann nicht angehen, daß wir Evangelischen und Katholischen umeinander dümpeln, ohne zu wissen, was der andere glaubt. Die Verunsicherungen – wenn wir nicht gerade Professoren der Theologie sind, und selbst da habe ich Zweifel – sind diesbezüglich sehr groß, noch größer natürlich unter allen, die wenig kirchlich sozialisiert sind. Aber es wächst zunehmend das Bedürfnis, etwas über die anderen zu erfahren. Diesem Bedürfnis sollten wir entsprechen und Klarheit schaffen, wo immer es uns möglich ist. Wir dürfen uns nicht genieren, scheinbar Selbstverständliches zu thematisieren – wir werden überrascht sein, wie wenig uns über uns selbst und erst recht über die anderen tatsächlich selbstverständlich ist. Der ökumenische Dialog lebt davon, daß wir mehr übereinander erfahren wollen. Ob wir es dann wirklich verstehen, gar akzeptieren, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber es scheint mir auf jeden Fall erstrebenswert, den ersten Schritt vor dem zweiten und dritten zu tun, und zwar auf allen Ebenen. Und es muß bewußt sein: Es gibt keine Klarheit ohne Pointen, und Pointen können schmerzen. Wenn aber gleichzeitig bewußt ist, daß es dabei um die Sache und nicht um Personen geht, dann ist es möglich, den Dialog ohne Beleidigungen und Verletzungen zu führen.
2. Dialog. Daß wir, Protestanten und Katholiken, miteinander reden, ist eine von diesen Selbstverständlichkeiten, die wir, ohne weiter darüber nachzudenken, hinnehmen. Schauen wir uns andere Länder an, in denen das nicht selbstverständlich ist, dann sollten wir Dankbarkeit dafür lernen, daß wir dies können. Ich erinnere nur an Nordirland. Der Dialog zur Klärung der Sache, um die es geht, bleibt unverzichtbares Mittel der Verständigung. Meinen Wunsch an die römisch-katholische Kirche an dieser Stelle möchte ich allerdings nicht verhehlen: Wir möchten und müssen als gleichberechtigter Gesprächspartner anerkannt werden. Wo uns das Kirche-Sein abgesprochen wird, scheint dies schlecht möglich zu sein.
3. Differenzierung. Natürlich gibt es in beiden Konfessionen eine riesige Bandbreite an Meinungen. Das macht es nicht immer leicht. Ein oft gehörtes Argument im Dialog ist: Was die da in Rom machen, das geht uns nichts an. Das scheint mir in der Tat zu einfach. Wenn ein Priester in seiner Gemeinde auch evangelische Christen zur Eucharistie zuläßt, dann muß er genauso wie diese evangelischen Christen wissen, was er da tut. Und im offiziellen Dialog nutzt es gar nichts, wenn Pfarrerin X und Priester Y vor Ort ganz anders denken und handeln als Kirchenleitungen und Bischof. Außerdem kann das ebenso beruhigend sein wie beunruhigend. Dennoch ist es natürlich wichtig, eine Vielzahl von Stimmen zu hören.
4. Themen. Der ökumenische Dialog scheint nach über 40 Jahren ein wenig in die Sackgasse geraten zu sein. Es wird wichtig sein, jetzt erneut über die Themen nachzudenken, über die zukünftig verhandelt werden soll. Rom hat sehr deutlich gezeigt, welche das sein müssen, und Rom hat recht. Wir müssen über das Amt und den päpstlichen Primat reden und nicht nur in diesem Kontext über das Schriftverständnis; wir müssen über den Kirchenbegriff und die Sakramente reden; und wir müssen immer wieder über die Relation Gott-Mensch reden und damit über Sünde, Gnade und Rechtfertigung, über Anthropologie und Soteriologie. Dazu müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Es haben bereits Dialoge auf vielfältiger Ebene statt gefunden, die als Hilfe dienen können. Aber es wird nötig sein, den Dialog an die Fundamente zurückzuführen um der Sache willen. Deshalb müssen es Theologen und Theologinnen auf beiden Seiten wagen, zu den genannten Fundamentalthemen zu schreiben, zu reden, zu lehren, in allen Disziplinen und über den eigenen Tellerrand hinaus. Luther hat verdeutlicht, daß ein solches Nachdenken kein Luxus ist angesichts der Nöte der Welt, sondern unabdingbare Voraussetzung für ein verantwortungsvolles Handeln.
5. Phantasie. Auf offizieller Ebene ist schon eine Menge ermöglicht worden, es hat nach dem 2. Vatikanischen Konzil einen ungeheuren Aufbruch gegeben, der seine Spuren hinterlassen hat. Das ist unbestreitbar so und kann nicht dankbar genug hervorgehoben werden. Aber es ist ebenso zu erkennen, daß diese offizielle Ebene auf beiden Seiten und aus guten Gründen in absehbarer Zeit nicht viel mehr zulassen wird. Wie heißt es so schön: Not macht erfinderisch. Das heißt nicht, aus der Not eine Tugend zu machen, sondern kreativ und gemeinsam darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten für ein Miteinander es dennoch gibt. Die Vergangenheit hat schon einen großen Erfindungsreichtum bewiesen. Ich stelle mir vor, daß vor allem auch die Universität zu einem Ort solcher Phantasie werden kann: durch gemeinsame Veranstaltungen, durch Symposien, durch gemeinsame Forschungsprojekte usw.
6. Ziele. Eine der größten Schwierigkeiten des ökumenischen Dialogs der vergangenen Jahrzehnte scheint mir gewesen zu sein, daß nie richtig klar war, wohin dieser Dialog eigentlich führen sollte: Kirchengemeinschaft? Schiedlich-Friedliches Mit- oder Nebeneinander? Versöhnte Verschiedenheit? Nach Klärung konfessioneller Einsichten und unter Beachtung konfessioneller Rücksichten kann nach meinem Verständnis überhaupt nur eine versöhnte Verschiedenheit möglich sein, und ich vermute, ich bin mit dieser Einsicht nicht allein. Es wäre redlich, das so zu benennen. Und gleichzeitig zu erkennen, daß dies nicht ein Zuwenig ist. Mit Luthers Kirchenbegriff ist das ein Leichtes, denn dann wäre klar, daß wir die erstrebte Einigkeit längst haben in der communio sanctorum, die wir allsonntäglich im Gottesdienst bekennen – wir haben sie allerdings nicht sichtbar. Es wäre natürlich schön, wenn sie in ein sichtbares Zeichen münden würde: in die Abendmahlsgemeinschaft. Das in der Tat ist nun ein römisches Problem und muß dort gelöst werden.
Wenn wir dies beherzigten und in gleicher Schärfe Anfragen an uns wie an unseren römisch-katholischen Gesprächspartner zuließen, dann bin ich getrost, daß wir ökumenischen Leichtsinn, konfessionellen Starrsinn und theologischen Unsinn vermeiden und TomTom am Ende flöten wird: „Nach 300 Metern: Sie haben Ihr Ziel erreicht.“
Anmerkungen
1 An den christlichen Adel, zit. nach: Luther deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart, hg. von Kurt Aland, Göttingen 1969ff. (10 Bde. + 1 Registerband), hier: Bd. 2, 160f. (im Folgenden zit. als aland-Luther)
2 Vgl. Assertio omnium articulorum, zit. nach: Martin Luther: Lateinisch-deutsche Studienausgabe Bd. 1: Der Mensch vor Gott, hg. und eingel. von Wilfried Härle, Leipzig 2006, 80/7. (im Folgenden zit. als LDS)
3 Vgl. dazu Assertio omnium articulorum: LDS 1, 79/11-15: „[Dies ist so zu verstehen], daß die Schriften nur durch denjenigen Geist zu verstehen sind, in dem sie geschrieben worden sind. Dieser Geist kann nirgendwo gegenwärtiger und lebendiger gefunden werden als eben in seinen Heiligen Schriften, die er geschrieben hat.“
4 Vgl. Assertio omnium articulorum: LDS 1, 80/23.
5 Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche: Aland-Luther 2, 184f.
6 Von der christlichen Freiheit: Aland-Luther 2, 251.
7 BSLK 427/7-13.
8 Aus der Ansprache Benedikt XVI. vom 19.08.2005 anläßlich des ökumenischen Treffens im erzbischöflichen Sitz in Köln im Kontext des XX. Weltjugendtages, zit. nach www.vatica.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/20… vom 20.08.2005.
Vortrag beim Kongreß des Gemeindehilfsbundes „Warum noch evangelisch?“ im Geistlichen Rüstzentrum Krelingen am 10.3.2007
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 12. März 2007 um 17:45 und abgelegt unter Theologie.