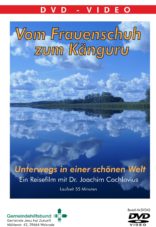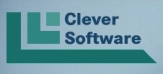Was ist der Mensch?
Montag 19. Januar 2015 von Pfr. Eduard Haller

Ein Beitrag zur alttestamentlichen Anthropologie.
„Am Tage, als Gott den Adam erschuf, schuf er ihn nach seinem Bilde, und zwar als Mann und als Frau schuf er sie und nannte sie ‘Mensch‘ “. (1. Mose 5, 1-2; vgl. 1. Mose 1,27)
1. Der beheimatete Mensch
Die sog. „priesterschriftliche Quelle“ in 1. Mose 1-11 definiert den Menschen als den je aufeinander bezogenen Mann und die Frau. „Adam“ (der aus dem „Erdboden“, der „adamah“ genommene [1. Mose 5,1]), ist nicht der Mann allein und die Frau allein, sondern der Mann und die Frau in ihrer Bezogenheit aufeinander und in ihrer Bestimmung füreinander.
So ist der Mensch „erschaffen“. Gott schuf ihn. Er kann sich nicht selbst erschaffen und sich auch nicht um-schaffen, als wäre sein Mann-sein und sein Frau-sein eine Sache seiner freien Wahl. Mann und Frau zusammen sind und heißen „Mensch“. Er, Gott, schuf sie so, und er nannte sie so. Daher ist der Mensch der sich in der Frau erkennende Mann und also auch der Mensch die sich im Mann erkennende Frau. Die Frau ist die dem Mann „entsprechende“ Hilfe und der Mann die der Frau „entsprechende“ Hilfe (1. Mose 2,18-23). Die sog. „jahwistische Quelle“ in 1. Mose 1-11 erläutert in erzählender Form, was die „priesterschriftliche Quelle“ bereits definiert hat.
1. Mose 2,18 spricht von der Hilfe, die Gott schuf, also die dem Mann „entsprechende“ Hilfe, die er sonst unter allen Kreaturen nicht finden kann (1. Mose 2,20). Gott will nicht den einsamen Menschen, sondern den beheimateten Menschen, den Menschen in der Gemeinschaft von Mann und Frau. Das Wort „gegenüber“, „entsprechend“, „gemäß“ heißt im Urtext nichts anderes als „passend“ („k’nägdo“). Die Frau ist die dem Mann „gemäße“, ihm „entsprechende“ Hilfe, sie ist sein „Gegenüber“. Das Wort des Erzählers in der Urgeschichte, das hier rein bildlich zu verstehen ist, ist das Wort von der „Rippe“ des Mannes („zel’a“). Mit „Rippe“ ist nichts anderes gemeint im hebräischen Erzählen als eben die andere „Seite“, das Gegenüber in der Einheit. „ezäl“ (die Seite einer Person oder einer Sache) und „zel’a“ besagen wie das hebräische Wort „nägäd“, „k’nägäd“ (gegenüber, ihm gegenüber, entsprechend, ihm entsprechend „k’nägdo“) das gleiche wie das Wort „Seite“, „Rippe“, „Ufer“, im Bildvergleich das gegenüberliegende „Ufer“ bzw. die andere Seite eines Sees. So also gehören „der Mann“ („isch“) und „die Frau“ („ischschah“, „die Männin“) zusammen. Mann und Frau zusammen sind „Adam“ und heißen beide „Mensch“. Was in 1. Mose 5,1-2 definiert ist, wird in 1. Mose 2, 18-23 bildhaft erzählerisch entfaltet.
„Eva“ ist der Name, den der Mann der Frau gegeben hat. „Eva“ kommt vom hebräischen Wort „chawwah“, die „Leben- schenkende“. („chawwah“ gehört zum Wort „chaj“, das „Leben“). „Eva“ ist des Mannes Gegenüber als die Leben-schenkende, die das Leben weitergebende Männin, die zur Mutterschaft berufene Frau, „Adam“ der Name für Frau und Mann.
2. Wer bin ich eigentlich?
Immer hat der Mensch nach sich selber gefragt: „Wer bin ich eigentlich?“ Der Philosoph Arthur Schopenhauer stieß einmal, tief in Gedanken versunken, unvorsichtig mit einem vornehmen Herrn zusammen, der ihn nicht kannte und barsch fragte: „Wer sind Sie eigentlich?“. Er gab zur Antwort: „Ich gebe ihnen hundert Gulden, wenn Sie mir sagen können, wer ich bin“. Ohne die Deutung durch die biblische Urgeschichte weiß der Mensch nicht, wer er ist. Es genügt nicht, was er von sich denkt, was er fühlt, was er will, was er kann, und wovon er weiß, was er nicht kann. „Der Mensch ist immer mehr, als er von sich weiß“ (Karl Jaspers). Aber eben: Was ist dieses „mehr“? Gewiss nicht, was Soziologen, Meinungsforscher, Naturwissenschaften und Abstammungslehren meinen und lehren, und schon ganz und gar nicht, was (Gender-) Ideologen oder „Geschlechterforscher/Innen“ erklären über den „mündig gewordenen“, den „autonomen“, Leben und Tod manipulierenden Menschen. Unsere Fragen enden im Widersprüchlichen, das unser Menschsein kennzeichnet, bis hin zu atheistischen Menschenbildern, die mit der Möglichkeit spielen, einen Transmann oder eine Transfrau herzustellen.
3. Die Notwendigkeit der Offenbarung
Wer wir wirklich sind, erfahren wir nur in der Begegnung mit dem wirklichen Gott, der uns angesprochen hat. Unter seiner Anrede, von seiner Selbstoffenbarung her wird der erst sich selbst offenbar. Dann wird Ungeheuerliches deutlich und zugleich Unfassbares, die richtende Wahrheit und das aufrichtende Wunder.
Das Ungeheuerliche: Der Urwiderspruch gegen den Schöpfer, das Selbstseinwollen des Menschen gegen Gott; der Wille, ohne Gott groß sein zu wollen. Der Mensch will aus sich allein heraus „wie Gott wissen“, „was gut und böse ist“ („Gut und böse“ heißt im hebräischen Erzählen so viel wie „allwissend“). Dieser Gott gleich sein wollende Mensch wird zur Rede gestellt. Adam, der Mensch, steht unter der bleibenden Frage: „Wo bist du, der du dich vor mir verstecken willst?“ Du kannst dich gar nicht vor mir verstecken. Du bist erkannt. Ich, dein Schöpfer, entdecke dich (1. Mose 3,9).
Dem folgt im Fortgang der Geschichte die wieder und weiter aufdeckende Frage: „Wo ist dein Bruder Abel?“ (1. Mose 4,9). Der vor Gott fliehende Mensch wird zum Mörder. Er bleibt es bis heute: „Er hat getötet, denn er ist ein Mensch“, sagt der Dichter Péter Esterhàzy von einem Menschen. Töten – das macht nur der Mensch. Das Tier tötet nicht. Es sucht nur seine Nahrung. Es verhält sich nur, es lebt instinktiv. Der Mensch aber verhält sich nicht. Er „tut“, obwohl er gar nicht „müsste“. Von den ersten Fragen der Bibel bis in unseren Alltag hinein kommt keiner los.
4. Unheil und Heil des Menschen
„Da sprach Gott: Alles Sinnen und Trachten des Menschenherzens ist böse“. So kommt das Ungeheuerliche über die Menschheit, Unheil, Sintflut, Urtrauma des Menschen, das durch alle Mythen geistert. Aber die Urgeschichte spricht nicht nur von Unheil, sondern auch von Heil: Denn die gleichen Worte Gottes kehren ja wieder im Segen über Noah, wo Gott der Menschheit eine Zukunft andeutet, indem er als Anfang den kreatürlichen Fortbestand für die Menschheit gewährt (1. Mose 6,5 und 8,21).
5. Der erlöste und gekrönte Mensch
Von da her spricht die Weisheit wie die Hymnik des Alten Testaments dann das unerhörte Wunder aus.Über aller Nichtigkeit des Menschseins ergeht eine unzerstörbare Verheißung (Ps. 103,16; 90,3-6.11-12; Ps. 103,17; Ps. 33,18.19). Was der Mensch hören musste (1. Mose 3,19b) und was er erfährt (Hiob 14,1), wird abgelöst durch das demütige Staunen des Menschen, der sich als aus dem Gericht gerettet erkennt als ein von Gott zur Würde erlöstes Geschöpf: „Was für ein Wunder ist es doch um den Menschen, dessen du dich, Gott, so annimmst. Mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt und setzt ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände!“ (Ps. 8,5ff.)
Hier wird der Blick auf den neuen Bund hin geöffnet, die Erlösung durch Christus, die Neuschaffung des Menschen im christlichen Glauben. Ja hier wird der Glaube selbst schöpferisch. Alle Heiligen waren schöpferische Menschen, und jedes Christenleben soll Frucht tragen und schöpferisch werden auch in unscheinbaren Lebenswegen, wenn sie nur treu gegangen werden. Siehe dazu die überquellende Fülle schöpferischer Kunst auf allen Gebieten aus dem Schoß der glaubenden Kirche.
Dies ist dann die Beglaubigung des biblischen Menschenbildes: Vom Verlust des Urstandes und vom Todesgericht ist der Mensch des Glaubens herausgerufen zum Heilsstand der Hoffnung im Gnadenbund Gottes, inmitten einer Tötungswelt ist er berufen zur Lebenswelt, zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde (2. Petrus 3,13; 1. Petrus 1,8-12).
Die Urform aller Lebensformen. Ein Nachwort
„Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm die Hilfe schaffen, die ihm entspricht.“ „Als Mann und Frau schuf sie Gott.“ (1. Mose 2,18; 1,27b)
Nein, es ist wirklich nicht gut, allein zu sein. Man kann furchtbar verlassen sein mitten in letztlich unverbindlicher nichts sagender Freundlichkeit. Mitten unter den heutigen Lebensformen, wo der Mensch schnell zum Verwaltungsobjekt verwaltender Bürokratie wird, oder zum Geschäftsobjekt oder zum Genussobjekt erniedrigt ist, mitten unter diesen verwirrten Formen von Zusammenleben und Nebeneinanderherleben, gibt es dieses Wunder, diese Urform des Lebens: gottgewirkte Liebesgemeinschaft zwischen Mann und Frau.
Von Anfang an geht es Gott um den von Vereinsamung bedrohten Menschen. Er schafft ihm „Hilfe, die dem Menschen entspricht“ die Frau dem Mann, den Mann der Frau, Liebesbund, Ehe.lm staunend liebenden Du findet der Mensch sich wieder, in dem, dem er sich schenkt: der Mann in der Frau, die Frau im Mann. Es gibt den Menschen gar nicht anders als so, in diesem Angewiesensein auf einander als Mann und als Frau. Das ist die Urform aller Lebensformen, Gegenüber sein und zugleich Einswerden im gemeinsamen Liebesweg, der hält und reift. Das ist Gottes heilsamer Wille.
„Ich bin dein und du bist mein“, heißt es dann im Zwiegespräch von Mann und Frau, ein immer neues Echo auf Gottes Schenken. „Ich war wohl klug, dass ich dich fand. / Doch fand ich nicht. Gott hat dich mir gegeben. / So segnet keine andre Hand.“ (Matthias Claudius). Zwei Menschen – und Gott, der Herr, darüber!
Dann aber öffnet sich die zweisame Einheit weit: Sie hat Kinder, sie hat offene Türen, sie hat Gäste, Freunde, Gespräch, Vertrauen, sie hilft, sie erfreut, sie nimmt teil, sie tut Gutes. Lieben ist ja nicht etwa nur ein einander Anschauen, sondern wird immer für andere ein miteinander Vorwärtsschauen. Nichts, weithin wie auch im Kleinsten, ist so wirksam nach außen wie die von Gott diesen zwei Menschen, Mann und Frau, geschenkte Liebe, ein Wunder.
Aber wenn mir dann der liebste Mensch genommen wurde? Wenn die schwerste Verletzung mich verwundet und auch die Narbe dieser Verwundung immer schmerzt? Gottgeschenkte Liebe wird dann verwandelt. Im Schmerz reift sie ewiger Vollendung entgegen. Dort gibt es dann keine Ehe mehr nach irdischer Weise, aber die Liebe wird wieder Liebesgemeinschaft sein, vollendete Gemeinschaft ohne Fehler. Gott trennt nie auf, was er gewoben hat. Er nimmt nicht zurück, was er einmal gegeben hat. Diese „Liebe hört niemals auf“ (1. Kor. 13,8).
Wo aber jemand zum ehelosen Leben berufen ist, oder wo im Lebensgang eheloses Leben gefügt ist, auch geschieht immer wieder dieses Wunder: dass alleinstehende Männer und Frauen je und je väterlich Bergendes und mütterlich Tröstendes in unsere oft so trostarme, weil egoistische Welt hineintragen. Vielfältige Hilfe, die dann dem entspricht, was jeder zum Heilwerden braucht und ersehnt.
Pfarrer Eduard Haller, St. Gallen
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 19. Januar 2015 um 16:40 und abgelegt unter Theologie.