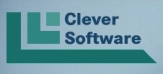Rezension: Mareile Lasogga, Orientierungslinien zur ethisch-theologischen Urteilsbildung am Beispiel der strittigen Bewertung von Homosexualität in christlicher Perspektive. (Texte aus der VELKD Nr. 170, Juni 2014)
Mittwoch 15. Oktober 2014 von Dr. Joachim Cochlovius

Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, der sieben lutherische Landeskirchen angehören, legt eine Handreichung vor, mit der „gravierende Differenzen“ zwischen den Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbundes in der Bewertung der Homosexualität überwunden werden sollen. Genaueres wird nicht gesagt, lediglich, dass man an „die Bearbeitung ethisch-theologischer Spannungen“ herangehen müsse. Vermutlich stehen im Hintergrund die Einwände vor allem afrikanischer Kirchen gegenüber der theologischen Legitimierung praktizierter Homosexualität, wie sie in etlichen lutherischen Kirchen Europas und in den U.S.A. üblich geworden ist. Der Text sieht an dieser Frage „die Einheit der Kirche gefährdet“. Die Lage scheint also ernst zu sein. Gespannt nimmt man deswegen diese „Orientierungslinien“ in die Hand und fragt sich, wie man die Risse in der weltweiten evangelischen Christenheit und bei uns wieder kitten will, die durch die These einer „verantwortlich gelebten Homosexualität“ entstanden sind, wie sie in Deutschland erstmalig in der EKD-Orientierungshilfe „Mit Spannungen leben“ von 1996 vertreten wurde.
Um es vorweg zu sagen: Diese Handreichung bietet keine überzeugende Lösung. Nach breiten Erörterungen zur ethisch-theologischen Urteilsbildung, zur Bedeutung der Bibel für den Glauben, zu den „Regeln des rationalen Diskurses“, zum theologischen Hauptkriterium „für kirchliche Entscheidungen in ethischen Problemlagen“ und zum kirchlichen Umgang mit theologischen Streitfragen wird als Lösung nichts anderes angeboten als die „Ermahnung, einander respektvoll und geduldig in Spannungen und trotz Spannungen zu ertragen“. Lutherische Kirchen, die praktizierte Homosexualität mit Paulus als Sünde verwerfen, sollen demnach „respektvoll und geduldig“ mit denjenigen Kirchen umgehen, die gleichgeschlechtliche Partnerschaften segnen und Amtsträgern, die in solchen Partnerschaften leben, das Pfarrhaus öffnen. Theologisch wird diese Forderung damit begründet, dass durch den Glauben an Christus, durch die Taufe und das Abendmahl die „Einheit in Christus“ begründet sei, „in der alle soziokulturellen Prägungen prinzipiell und endgültig relativiert sind“.
Um gleich bei diesem völlig unbefriedigenden Lösungsangebot der „Orientierungslinien“ zu bleiben: Der Versuch, Toleranz für die Anerkennung homosexueller Praxis mit dem Hinweis auf die „Einheit in Christus“ einzufordern, hält weder vor dem reformatorischen Bekenntnis noch vor dem Einheitsbegriff des Neuen Testaments stand.
Im Augsburger Bekenntnis heißt es klar und deutlich, dass die wahre Einheit der Kirche auf der Übereinstimmung „in der Lehre des Evangeliums und in der Verwaltung der Sakramente“ beruht (Art. 7). Diese Übereinstimmung ist zwischen der EKD und denjenigen Kirchen, die homosexuelle Praxis ablehnen, nicht mehr gegeben, denn im Pfarrdienstgesetz der EKD von 2010 werden gleichgeschlechtliche Partnerschaften im Pfarrhaus entgegen dem klaren Zeugnis des Neuen Testaments anerkannt. Damit wurde die kirchliche Einheit zerbrochen. Von einer „Einheit in Christus“ kann nicht mehr die Rede sein.
Ebenso wenig lässt die Lehre der Apostel von der christlichen Einheit eine Toleranz für die Anerkennung homosexueller Praxis zu. Nach Eph 2,20 wird die „Einheit in Christus“ gewährleistet durch das Fundament, das von den Aposteln und Propheten gelegt wurde. Außerhalb der apostolischen Lehre kann es also keine kirchliche Einheit geben. Die Ablehnung homosexueller Praxis durch die Apostel ist aber offenkundig. Nach Eph 5,1-9 sollen die Christen die „Einheit in Christus“ in christlicher Nächstenliebe leben und als „Kinder des Lichts“ jegliche Art von Unzucht, Habsucht und liebloser Rede überwinden. Von irgendeiner Toleranz gegenüber solchen Verhaltensweisen ist nicht die Rede. Insofern ist auch der neutestamentliche Befund eindeutig.
Wie kommen die VELKD-Orientierungslinien zu einem solchen theologisch völlig unhaltbaren Ergebnis? Es lohnt, die hauptsächlichen Argumentationslinien in den fünf Abschnitten nachzuzeichnen, u. a. auch deswegen, weil sie so oder ähnlich auch in anderen kirchlichen Verlautbarungen immer wieder begegnen.
Schon im ersten Abschnitt „Methodische Vorüberlegungen zur ethisch-theologischen Urteilsbildung“ wird der Leser skeptisch. Eine „ethische Entscheidung“, so heißt es dort, soll „der Verwirklichung der biblisch bezeugten Bestimmung des Menschen und seiner Welt“ dienen. Was die „Bestimmung des Menschen“ ist, wird nicht gesagt. Statt dessen wird aufgezählt, was bei anstehenden ethischen Entscheidungen besser nicht in Anspruch genommen werden sollte: nämlich die „individuelle Gewissensbindung“, der „status confessionis“, die „Tradition“ und die „vermeintliche Evidenz moralischer Normen“. Die Begründung: Diese Instanzen können „nicht mehr kritisch hinterfragt werden“, sie lassen sich „diskursiv nicht plausibilisieren“, sie können „in der Diskussion mit anders Denkenden auch keine Überzeugungskraft entfalten“. Der Leser ist perplex! Luther hätte sich also nach dieser Auffassung in Worms nicht auf das Gewissen berufen dürfen, weil es für den Kaiser „keine Überzeugungskraft“ hatte. Im Übrigen widerspricht die Handreichung sich selber, wenn sie später im 2. Abschnitt feststellt, dass „der durch die Schrift geweckte Glaube…den Menschen in seinem Gewissen“ bindet. Überträgt man die weitere Aussage über die „vermeintliche Evidenz moralischer Normen“ auf biblische Normen, etwa die Zehn Gebote, stößt man schnell auf die fatalen Konsequenzen dieser Behauptungen. Nach den VELKD-Orientierungslinien dürften sie letztlich bei ethischen Entscheidungsprozessen nicht in Anspruch genommen werden, weil sie sich ja „diskursiv nicht plausibilisieren lassen“. Einem Ehebrecher dürfte man also nicht mehr entgegenhalten, dass er die Ehe nach Gottes Willen nicht brechen darf, wenn ihm das nicht plausibel ist. Was ist das in der Konsequenz für eine Ethik! Wir haben hier nichts anderes vor uns als die Auflösung jeglichen ethischen Anspruchs an Menschen und jeglicher normativer Bindung für das menschliche Zusammenleben! Der Anspruch Gottes auf den Menschen wird theologisch zunichte gemacht. Die reformatorische Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium wird zerstört, denn das Gesetz fordert den Willen Gottes ein, ohne dass es sich vorher plausibel macht.
In wünschenswerter Deutlichkeit formulieren die „Orientierungslinien“: „Einer bestimmten biblischen Aussage zu einer ethischen Frage lässt sich nicht unmittelbar eine Handlungsdirektive entnehmen. Denn zwischen theologischen Lehraussagen und ethischen Imperativen besteht eine kategoriale Differenz“. „Theologische Normen“ müssten in die Gegenwart vermittelt werden, die herausgefordert sei, „zu den spezifischen Fragen und Problemen…eigenverantwortete Antworten zu finden“, die „nach evangelischem Verständnis nur im freien Diskurs gleichberechtigter Interpreten auf der Grundlage der Heiligen Schrift“ gewonnen werden könnten. Es ist offensichtlich, dass in einer solchen Diskursethik der normative Charakter der Bibel auf der Strecke bleibt. Nicht das Wort Gottes, sondern die „eigenverantwortete Antwort“ ist die letzte Norm. Was das konkret bedeutet, hat die sog. Rosenheimer Erklärung der bayrischen Landessynode schon 1991 praktiziert. Dort wurde die letzte Entscheidung über Leben und Tod des ungeborenen Kindes nicht dem Wort und Gebot Gottes vorbehalten, sondern in die Hand der schwangeren Frau gelegt. „In Konfliktsituationen kann die letzte Entscheidung der betreffenden Frau von niemandem abgenommen werden; sie muss sie in der Verantwortung vor Gott treffen“. Man fragt sich: Wie lange wollen evangelische Kirchenleitungen noch einer solchen Ethik folgen, in der die Selbstbestimmung des Individuums über die Autorität des Wortes Gottes gestellt wird?
Der zweite Abschnitt „Anmerkungen zur Bibelhermeneutik“ widmet sich dem Bibelverständnis. Unter vielfacher Berufung auf Martin Luther wird die Selbstauslegung und die Wirksamkeit der Schrift beim Leser und Hörer betont. Dieser Prozess sei „ein existenzielles Geschehen, das den Menschen in seinem Selbsterleben und Selbstverstehen ergreift und grundlegend bestimmt“. So weit, so gut. In einem sehr allgemeinen Sinn könnte man die Begegnung des Menschen mit Gottes Wort evtl. so umschreiben, wenn auch die eigentliche Wirkung des Wortes Gottes gar nicht genannt wird, nämlich dass es zur Sündenerkenntnis und zur Christuserkenntnis führt. Wenn man dann aber weiter liest, dass die Schrift ein neues „Selbstverständnis“ eröffnet, und dass dabei „die Glaubensüberlieferung im Kontext heutiger Lebenserfahrung vergegenwärtigt und die Lebenserfahrung als Material des Glaubens reflektiert wird“, merkt man, worauf diese Hermeneutik abzielt. Der autonome Mensch vergegenwärtigt sich die Glaubensaussagen der Bibel und entscheidet, ob und wie er sie sich zunutze macht. Das ist etwas ganz anderes als das, was im Augsburger Bekenntnis zur Wirkung der Heiligen Schrift steht. Dort heißt es im 6. Artikel, dass der durch das Wort Gottes geweckte Glaube „gute Früchte und gute Werke bringen soll“ und dass der Christ „die von Gott gebotenen Werke“ tun muss, „weil Gott es will“. Es geht also um den neuen Gehorsam. Nicht der Mensch entscheidet also nach evangelischem Verständnis darüber, ob und was er vom Wort Gottes anerkennt und annimmt, sondern Gott hat entschieden, beim Menschen durch Gesetz und Evangelium Glauben zu wecken und ihn dann zu einem neuen Gehorsam zu rufen. Die von der VELKD hier propagierte Dialoghermeneutik macht trotz aller Lippenbekenntnisse zur Selbstauslegung der Schrift aus der Bibel einen Dialogpartner des Menschen. Ein Bekenntnis zur unbedingten Autorität der Heiligen Schrift sucht man vergeblich.
Im dritten Abschnitt lesen wir „Überlegungen zum Verhältnis von Theologie und Kultur“. Die Orientierungslinien stellen hier die These auf, dass es sog. unhintergehbare kulturelle Plausibilitäten bzw. „gesamtgesellschaftliche Voraussetzungen“ gibt, die das Denken der Menschen bestimmen. Dazu werden in der Gegenwart z. B. die „Achtung der Menschenwürde“ und der „kulturelle Deutungsanspruch der aufgeklärt-kritischen Vernunft“ gezählt. Warum diese zweifellos vorhandenen Denkmuster allerdings nicht hinterfragt werden können, wird nicht ausgeführt. Mich erinnert diese Behauptung an eine Frage, die man an unseren Theologischen Fakultäten immer wieder zu hören bekommt: „Sie wollen doch wohl nicht etwa wieder hinter die Aufklärung zurück?“ Dass der Heilige Geist im Leben eines Christen ein ganz neues Denkmuster begründet, scheint diesen Thesen- und Fragestellern nicht bewusst zu sein. Dem wandelbaren öffentlichen Bewusstsein wird hier geradezu eine Offenbarungsqualität zugebilligt. So kommt es dann zu solchen törichten Forderungen, dass der „Geltungsanspruch des Evangeliums in einer begrifflich und methodisch nachvollziehbaren Weise“ vertreten werden solle, „die argumentativ anschlussfähig ist an die öffentlichen Debatten in Wissenschaft und Gesellschaft“. Haben die maßgeblichen Männer und Frauen der VELKD nie 1 Kor 2 gelesen, wo Paulus genau das Gegenteil sagt? Dass er nämlich von einer der Welt verborgenen Weisheit Gottes redet und dass der natürliche Mensch vom Geist Gottes nichts vernehmen kann, dass ihm die Botschaft des Evangeliums wie eine Torheit erscheint. Wie kann man angesichts solcher Aussagen fordern, dass der „Wahrheitsanspruch des Glaubens und das damit verbundene Verständnis der Wirklichkeit“ in „argumentativ durchsichtiger Weise“ „in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen“ sind? Das Wort Gottes setzt sich immer durch. Entweder ruft es Verstockung oder geistliche Erweckung hervor. Es muss nur bezeugt werden, aber nicht „mit überredenden Worten menschlicher Weisheit“ (1 Kor 2,4), sondern im Glauben, mit demütigem Herzen und in geschenkter Vollmacht. Es ist wie ein Feuer und wie ein Hammer (Jer 23,29), tausendmal wirksamer als die besten Argumente der menschlichen Vernunft.
Die Orientierungslinien sehen offensichtlich auch die weitgehende gesellschaftliche Anerkennung der Homosexualität in Deutschland als eine neue „gesamtgesellschaftliche Voraussetzung“. Jedenfalls schildern sie eingehend den Prozess ihrer zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz, beginnend mit dem Wegfall des Paragraphen 175 StGB im Jahr 1994 (im Text steht fälschlicherweise 1988). Ferner werden Daten zum „Prozess der Entpathologisierung durch Psychologen und Psychiater“ genannt.
Mit keinem Wort wird die negative Einschätzung der Homosexualität durch die biblischen Autoren und in der Kirchen- und Dogmengeschichte erwähnt. Man hätte wenigstens einen Hinweis auf die EKD-Orientierungshilfe „Mit Spannungen leben“ von 1996 erwartet, wo im exegetischen Teil festgestellt wurde, dass die Bibel einhellig homosexuelle Praxis als Fehlhaltung verwirft. Ebenso bleibt die innerevangelikale Diskussion unerwähnt, wie auch die internationale Ex-Gay-Bewegung und die Hilfsangebote für Menschen, die ihre homosexuellen Empfindungen überwinden möchten. Eine derartige Einseitigkeit in einem Kapitel, das sich mit dem Verhältnis von Theologie und Kultur befasst, ist unseriös und diskreditiert nicht nur die Verfasserin, sondern letztlich die ganze VELKD-Kirchenleitung.
Dann werden in einem vierten Abschnitt „Theologisch leitende Begründungskriterien für den Umgang mit Homosexualität“ gesucht. Hier geht es vor allem um das Menschenbild. Im Gegensatz zum scholastischen Modell von Natur und Übernatur wird der anthropologische Ansatz Luthers favorisiert, der den Menschen in seinen verschiedenen Beziehungsfeldern vor Gott, vor der Welt, vor den Menschen und vor sich selbst sieht. Hier kann man gute Gedanken zum christlichen Leben „coram Deo“ lesen. Im Anschluss an 1 Kor 7,29ff wird von der vorletzten Bedeutung der „Dinge der Welt“ und von der Vorrangigkeit der neuen Schöpfung in Christus gesprochen. Interessant ist die Schlussfolgerung in Bezug auf kirchliche ethische Entscheidungen. Das leitende Kriterium hierfür soll die Frage sein, ob durch sie „die Teilhabe an der Heilswirklichkeit in Christus…befördert oder verdunkelt“ wird. Diese Frage kann man in der Tat stellen. Viele kirchliche Entscheidungen, Verlautbarungen und Verordnungen tauchen da aus der Erinnerung auf, angefangen bei der schon erwähnten Rosenheimer Erklärung von 1991 bis hin zum ebenfalls erwähnten Pfarrdienstgesetz von 2010. Wurde durch sie die Teilhabe an Christus gefördert oder behindert?
Die theologische Antwort muss lauten: Wenn Gottes Wort uneingeschränkt als Gesetz und Evangelium verkündigt wird, wenn Sünde beim Namen genannt wird, wenn durch Gottes Gnade ein Mensch geistlich neu geboren wird durch die Kraft des Heiligen Geistes, wenn der Christ zum neuen Gehorsam ermahnt wird, dann wird die Teilhabe an Christus gefördert. Wenn aber die Heilige Schrift ihrer Autorität beraubt und sie herabgewürdigt wird zu einem bloßen Dialogpartner, wenn das Leben des natürlichen Menschen nicht mehr im Licht der apostolischen Lehre als Knechtschaft unter Sünde, Tod und Teufel beschrieben wird, wenn durch eine so beschnittene Botschaft keine Bekehrungen geschehen, wenn keine geistlichen Ermahnungen mehr gegeben werden, den alten Menschen auszuziehen und neuen Menschen anzuziehen, dann wird die Teilhabe an Christus verdunkelt. Die VELKD-Orientierungslinien sind ein Beispiel für eine solche Verdunkelung.
Der fünfte Abschnitt zieht „Konsequenzen für den kirchlichen Umgang mit Dissensen“. Hier wird die Frage aufgeworfen, wie evangelische Kirchen mit ethischen Lehrkonflikten umgehen sollten. Zwei Modelle werden genannt. Einmal die „Konsensfindung auf der Basis von Konsenspapieren“, zum anderen die Überzeugung, „dass die Einheit bzw. Einmütigkeit der Kirche nicht in Konsensen gründet, sondern im Geist der Liebe“. Deutlich wird das zweite Modell bevorzugt. Das Grundmuster hierfür sei das Apostelkonzil, „das die Heiden- und Judenmission als zwei Weisen anerkennt, den gemeinsamen Auftrag der Verkündigung in unterschiedlichen Gestaltungsformen wahrzunehmen und die damit verbundenen theologischen Dissense…in ihrer Spannung auszuhalten“. Als Muster für den Umgang mit unterschiedlichen Auffassungen gegenüber praktizierter Homosexualität eignet sich das Apostelkonzil allerdings überhaupt nicht, denn in dieser Kontroverse konnten sich beide Seiten auf Weisungen aus Gottes Wort berufen. Die strengen Judenchristen konnten sich ebenso gut auf das Alte Testament beziehen wie Paulus auf Offenbarungen des erhöhten Herrn. Hinsichtlich der Bewertung homosexueller Praxis können sich die Befürworter jedoch nicht auf Gottes Wort beziehen. Nirgends gibt es in der Heiligen Schrift ein positives Urteil darüber, im Gegenteil.
Dann wird ein zweiter Anlauf genommen, um eine theologische Brücke zwischen den Fronten zu schlagen. Und zwar wird die durch die Taufe begründete Einheit der Kirche herausgestellt und behauptet, dass dadurch „die sozialen und kulturellen Unterschiede – wie auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den sexuellen Identitäten“ aufgehoben seien. U. a. wird dabei Bezug genommen auf Gal 3,28, eine Stelle, die auch von der Gender-Ideologie immer wieder angeführt wird, um die angebliche Aufhebung der geschlechtlichen Identität von Männern und Frauen durch Christus zu begründen. Wie unsinnig derartige Behauptungen sind, zeigt schon ein Blick auf die neutestamentlichen Haustafeln, wo die unterschiedlichen Pflichten von Männern und Frauen nicht wegdiskutiert, sondern herausgestellt werden. Ebenso ist auch die These abwegig, „dass der Status der Christen allein durch ihre Zugehörigkeit zu Christus bestimmt ist und nicht durch alltagsweltlich differente Existenzorientierungen“ bestimmt sei. Die Zugehörigkeit zum Leib Christi durch Glaube und Taufe entbindet den einzelnen Christen gerade nicht vom neuen Gehorsam, sondern verpflichtet ihn, seine „Existenzorientierung“ (um dieses merkwürdige Wort einmal zu gebrauchen) nun an der Liebe zu Gott, an Gottes Geboten, an der Lehre der Apostel und an der Liebe zum Nächsten neu auszurichten.
Auf das dürftige Gesamtergebnis der VELKD-Orientierungslinien wurde bereits oben eingegangen. Diese Handreichung ist theologisch unzureichend, weil sie aus richtigen Einsichten Luthers falsche Folgerungen zieht, sie ist im Blick auf die Fakten zur Homosexualität sachlich unausgewogen, und sie ist insgesamt ungeeignet, kirchliche Befürworter und Gegner praktizierter Homosexualität einander näher zu bringen.
Pastor Dr. Joachim Cochlovius
Quelle: Aufbruch – Informationen des Gemeindehilfsbundes, II/2014
Der Aufbruch erscheint 2-3 x jährlich und kann über die Geschäftsstelle des Gemeindehilfsbundes (05161/911330; info@gemeindehilfsbund.de) kostenlos bezogen werden.
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Mittwoch 15. Oktober 2014 um 13:19 und abgelegt unter Rezensionen, Sexualethik, Theologie.