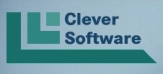Institutionenkindheit besser als Familienerziehung?
Mittwoch 15. Dezember 2010 von Institut f√ľr Demographie, Allgemeinwohl und Familie e. V.
Moderner Aberglaube:
Institutionenkindheit ist besser als Familienerziehung
‚ÄěDas h√∂chste Ma√ü an Gerechtigkeit erreichen wir nicht durch h√∂here Transfers, sondern durch den Ausbau der sozialen Infrastruktur.“ So begr√ľndet der Sprecher des ‚Äěkonservativen Fl√ľgels“ der SPD seinen Vorschlag, das Kindergeld um 30 Euro zu k√ľrzen, um stattdessen in Kinderbetreuung und Ganztagsschulen zu investieren. Die SPD-Spitze wollte zwar nicht von K√ľrzungen sprechen stimmte ihm aber grunds√§tzlich zu: F√ľr Kindergelderh√∂hungen gebe es keine ‚ÄěSpielr√§ume“, weil ‚ÄěInvestitionen in die Infrastruktur Vorrang haben m√ľssten“ (1). Familien sollen also Kaufkraftverluste hinnehmen, damit der Staat ihre Kinder¬†– versprochen wird besser und professioneller¬†– erziehen und bilden kann. Dabei hat die Kinderbetreuungsinfrastruktur f√ľr die Bundesregierung ohnehin seit Jahren Priorit√§t: Zwar erh√∂hte sie 2008/2009 widerwillig noch einmal das Kindergeld; zugleich trieb sie jedoch mit der ‚ÄěKrippenoffensive“ den um 2002 begonnenen Paradigmenwechsel zur sogenannten ‚Äěnachhaltigen“ Familienpolitik voran (2). Dieser zielt darauf ab, dass Kinder von klein auf ‚Äěeinen wesentlichen Teil des Tages in √∂ffentlich organisierten und verantworteten Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen“ verbringen. Der Direktor des Deutschen Jugendinstituts benennt die Konsequenzen dieser Politik f√ľr den Alltag von Kindern mit dem Begriff der ‚ÄěInstitutionenkindheit“ (3).
F√ľr die ‚Äěalten Bundesl√§nder“ in Westdeutschland ist dies eine ‚Äěstille Revolution“: Bisher pr√§gte die Familie die Kindheit; √∂ffentliche Kinderbetreuung war lange ‚Äěallenfalls eine mehr oder minder punktuelle Erg√§nzung der privaten Erziehung“ (4). Das Gros der Erziehungsarbeit leisteten dabei die M√ľtter. Im Zuge ihrer steigenden Erwerbsneigung f√ľhrte dies zum vielfach kritisierten Problem der ‚ÄěDoppelbelastung“. Schon seit den 1970er Jahren forderten deshalb Familien- und Frauenpolitiker(innen) neben mehr Familienengagement von V√§tern und familienfreundlicheren Arbeitszeiten auch bessere Kinderbetreuungsm√∂glichkeiten. √Ėffentliche Institutionen sollten die famili√§re Erziehung jedoch keinesfalls verdr√§ngen: Als ihre Aufgabe galt es, die Eltern subsidi√§r darin zu unterst√ľtzen, ihre Kinder selber zu erziehen (5). Dieser Vorrang der famili√§ren Erziehung pr√§gte bis in die j√ľngste Zeit das Bewusstsein der Westdeutschen: Dem ‚ÄěGenerations and Gender Survey“ zufolge sahen sie noch 2005 mehrheitlich in den Eltern die besten Erzieher ihrer (kleinen) Kinder (6).
Dem Paradigmenwechsel hin zu einer entfamilisierten Kindheit steht dieser vermeintlich antiquierte Familiensinn im Wege (7): Regierungssachverst√§ndige definierten 2002 als Ziel der ‚Äěgesamten Gesellschaftspolitik“, im Blick auf die au√üerh√§usliche Kinderbetreuung ein neues ‚Äěgesellschaftliches Bild von Normalit√§t“ durchzusetzen (8). Dieser Aufgabe widmet sich nun seit Jahren eine breite ‚Äěadvocacy coalition“ in Politik und Bewusstseinsindustrie. Woche f√ľr Woche wiederholen regierungsamtliche Mitteilungen, Stellungnahmen von Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeberverb√§nden sowie vor allem Presse- und Rundfunkbeitr√§ge dieselbe Botschaft: Institutionelle Ganztagsbetreuung- und Beschulung von Kindern ist der Schl√ľssel zu mehr Chancengerechtigkeit, einem besseren Bildungsniveau und damit zu mehr Wohlstand in der globalisierten Wissensgesellschaft. Wer dieser Verhei√üung nicht glaubt, soll durch finanziellen Druck gezwungen werden ihr zu folgen; manche scheuen sich nicht einmal, einen gesetzlichen Kita- und Ganztagsschulzwang zu fordern. Ihre Anh√§nger begr√ľnden die institutionelle Ganztagsbetreuung mit M√§ngeln famili√§rer Erziehung, die eine st√§rkere ‚Äě√∂ffentliche Verantwortung“ f√ľr das Aufwachsen von Kindern erforderten (9).
Doch wer erzieht die Kinder in Betreuungseinrichtungen, Kantinen und Pausenh√∂fen? Im √∂ffentlichen Raum prallen in einer immer heterogeneren Gesellschaft sich h√§ufig widersprechende Interessen, Bed√ľrfnissen und Werte aufeinander. Im Falle der unvermeidlichen Konflikte halten sich Lehrer und Erzieher h√§ufig eher zur√ľck: Die Kinder bleiben sich selbst √ľberlassen, den Alltag bestimmen dann die ‚Äěpeer groups“. Dort setzen sich die St√§rkeren und oft die R√ľcksichtsloseren durch, w√§hrend schw√§chere und sensiblere Kinder leiden. Ist das gerecht? Wer sch√ľtzt diese Kinder, wenn ihre Eltern es nicht (mehr) k√∂nnen? Die Advokaten der ‚ÄěInstitutionen-Kindheit“ in Politik und Medien k√∂nnen keine Antworten bieten¬†– schon weil sie sich solche Fragen erst gar nicht stellen.
 (1) Siehe: Rheinische Post Online vom 7.12.2010: http://www.rp-online.de/politik/deutschland/Steinmeier-Mit-mir-keine-Streichung_aid_939590.html.
(2) Schon 2006/2007 gab es (aus der Bundesregierung heraus) Pl√§ne das Kindergeld zu k√ľrzen bzw. ‚Äěeinzufrieren“, um den Betreuungsausbau zu finanzieren: Stefan Fuchs: Der politische Kampf gegen die traditionelle Familie und die Erziehungsverantwortung der Eltern: http://www.erziehungstrends.de/Kompetenzzentrum/Familienleistungen. Zur nachhaltigen Familienpolitik siehe auch: http://www.i-daf.org/218-0-Woche-37-2009.html.
(3) Siehe: Thomas Rauschenbach: Vorwort, S. 25-27, in: Bundesministerium f√ľr Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Bericht √ľber die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland (Zw√∂lfter Kinder- und Jugendbericht), Bundestagsdrucksache 15/6014, Berlin 2005, S. 25.
(4) Der Direktor des Deutschen Jugendinstituts res√ľmiert im R√ľckblick: ‚ÄěDemgegen√ľber war damals¬†– wohlgemerkt: wir reden vom Ende der 1980er-, nicht der 1950er Jahre¬†– die √∂ffentliche Kinderbetreuung allenfalls eine mehr oder minder punktuelle Erg√§nzung der privaten Erziehung, weit davon entfernt, f√ľr alle Familien und Kinder ein selbstverst√§ndliches Angebot, gar ein Ganztagsangebot zu sein. [?] Man kann also f√ľr die Bonner Republik mit Fug und Recht behaupten, dass bis zu dieser Phase die Frage der Kinderbetreuung vor der Einschulung eindeutig Privatsache war. Siehe: Thomas Rauschenbach: Neue Orte f√ľr Familien. Institutionelle Entwicklungslinien eltern- und kinderf√∂rdernder Angebote, S. 133-155, in: Angelika Diller et al (Hrsg.): Familie im Zentrum: Kinderf√∂rdernde und elternunterst√ľtzende Einrichtungen¬†– aktuelle Entwicklungslinien und Herausforderungen, Wiesbaden 2008, S. 134.
(5) Beispielhaft f√ľr diese fr√ľher von SPD- wie CDU- gef√ľhrten Regierungen vertretene Position: ‚ÄěDie Bundesregierung anerkennt und w√ľrdigt die gro√üe Leistung der Familien bei der Erziehung und Sorge f√ľr die Kinder. […] Im Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder sieht die Bundesregierung kein vom Staat abgeleitetes, sondern ein origin√§res Recht der Familien. […] Die gesellschaftlichen Bedingungen m√ľssen so umgestaltet werden, dass M√§nner ebenso wie Frauen in der Lage sind, Aufgaben der Familie wahrzunehmen [?]. Das bedeutet vor allem auch eine Umgestaltung der Arbeitswelt, die in ihren Strukturen und Abl√§ufen st√§rker auf famili√§re Belange R√ľcksicht nehmen muss. Siehe: Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht der Sachverst√§ndigenkommission f√ľr den Dritten Familienbericht, S. 3-19, in: Die Lage der Familien in der Bundesrepublik Deutschland¬†– Dritter Familienbericht¬†– Deutscher Bundestag 8. Wahlperiode Drucksache 8/3120, S. 4-7.
(6) Vgl.: Andreas Ette/Kerstin Ruckdeschel: Die Oma macht den Unterschied! Der Einfluss institutioneller und informeller Unterst√ľtzung f√ľr Eltern auf ihre weiteren Kinderw√ľnsche, S. 51-72, in: Zeitschrift f√ľr Bev√∂lkerungswissenschaft, Jg. 32, 1-2/2007, S. 61. Zu den markanten Unterschieden in der Haltung zu M√ľttererwerbst√§tigkeit und Kinderbetreuung zwischen West- und Ostdeutschland: Stefan Fuchs: Einstellungen zu Familie und Erwerbst√§tigkeit in Europa¬†– Ostdeutschland als Avantgarde der¬† ‚ÄěModerne?“ www.erziehungstrends.de/Familie/Ostdeutschland.
(7) Der zw√∂lfte Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung bem√§ngelte, dass sich in Westdeutschland integrierte Konzepte der Kindergartenp√§dagogik mit ‚ÄěBildungsanspruch und entsprechend l√§ngeren Betreuungszeiten“ lange Zeit nicht durchsetzen konnten. Dies sei nicht ‚Äězuletzt einem b√ľrgerlichen Familien- und Mutterideal geschuldet“ gewesen, ‚Äědas die Mutterrolle mit der Hausfrauenrolle assoziiert und die Aufzucht der Kleinkinder im familialen Rahmen vorsieht“. Siehe: Bundesministerium f√ľr Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Zw√∂lfter Kinder- und Jugendbericht, op. cito, S. 166.
(8) Gewisserma√üen zum ‚ÄěAuftakt des Paradigmenwechsels“ hie√ü es im Elften Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung: ‚ÄěWeder die infrastrukturellen Rahmenbedingungen noch ein gesellschaftliches Bild von Normalit√§t im Hinblick auf au√üerh√§usliche bzw. anders als privat organisierte Betreuung und Bildung von Kindern sind heute ausreichend vorhanden bzw. g√ľltig. Dies durchzusetzen, kann nicht nur Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe sein, sondern ist Aufgabe der Jugendpolitik und dar√ľber hinaus der gesamten Gesellschaftspolitik. Siehe: Bundesministerium f√ľr Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Bericht √ľber die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland (Elfter Kinder- und Jugendbericht), Berlin 2002, S. 252.
(9) Der Zw√∂lfte Kinder- und Jugendbericht argumentierte wie folgt: ‚ÄěAufgrund eines niedrigen Bildungsniveaus, verbunden mit sozial benachteiligten und prek√§ren Lebenslagen sowie unter ung√ľnstigen sozio√∂konomischen Bedingungen, gelingt es vielen Familien nicht, die Bed√ľrfnisse ihrer Kinder zu erf√ľllen, ihnen gen√ľgend Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen und ihnen anregungsreiche Bedingungen des Aufwachsens zu bieten. [?] Das angesammelte Wissen √ľber Entwicklungsbedingungen, Entwicklungsbeeintr√§chtigungen und -risiken von kleinen Kindern macht einen Dialog und eine gemeinsam geteilte Verantwortung f√ľr das Aufwachsen der Kinder erforderlich. Die Verantwortung daf√ľr, dass Kinder sich positiv entwickeln, kann nicht einseitig der einzelnen Familie √ľbertragen werden; sie muss im Rahmen eines neuen Verst√§ndnisses von √∂ffentlicher Verantwortung gemeinsam √ľbernommen werden.“ Siehe: Bundesministerium f√ľr Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Zw√∂lfter Kinder- und Jugendbericht, op. cito, S. 33-34.
IDAF, Woche 49-50, Dezember 2010
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Mittwoch 15. Dezember 2010 um 15:26 und abgelegt unter Ehe u. Familie, Gesellschaft / Politik.