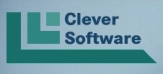Die Krise der Ehe und die Lebensformen der Geschlechter
Freitag 15. Oktober 2004 von Prof. Dr. Ulrich Eibach

Die Krise der Ehe und die Lebensformen der Geschlechter
1. Problemanzeige: Der âZeitgeistâ als hermeneutischer SchlĂŒssel?
Die Ehe ist â glaubt man den âGebildetenâ unter ihren VerĂ€chtern – ein âauslaufendesâ und zudem noch repressives Modell, das man endgĂŒltig auf die Abstellgleise vorgestriger Wertvorstellungen deponieren sollte. Auch in den Kirchen will man den AnschluĂ an die âPostmoderneâ nicht verlieren, in der immer neue Lebensformen der Geschlechter entwickelt werden. Wie soll man sich zu diesen neuen Lebensformen (freie Lebensgemeinschaften, Lebensabschnittsbeziehungen, homosexuelle und auch bisexuelle Beziehungen u.a.) verhalten? Diskriminiert man die Menschen nicht, die so leben, wenn man seitens der Kirchen an den âInstitutionenâ Ehe und Familie als allein gĂŒltige normative Leitbilder fĂŒr das Leben der Geschlechter festhĂ€lt? Sollte man die Ehe nicht als eine mögliche Lebensform unter anderen betrachten oder ihr bestenfalls eine gewisse Vorrangstellung einrĂ€umen? Und widerspricht eine mögliche Diskriminierung nicht der Liebe, ja entspricht es nicht der Liebe, auch solchen Lebensformen den kirchlichen Segen zu erteilen? Aber ist das Gebot, Menschen nicht zu diskriminieren, schon ein hinreichender Grund, ihre Lebensform kirchlich zu sanktionieren oder sie sogar als gleichwertig anzuerkennen und zu segnen? Woraus leitet sich die kirchliche Legitimation zum Segnen ĂŒberhaupt ab, aus den gesellschaftlichen Wandlungen und dem, was âcommon senseâ ist? NatĂŒrlich nicht, werden die meisten in der Kirche sagen, sondern aus der Liebe. Aber wer definiert, was Liebe ist, jeder fĂŒr sich oder â was nicht selten auf das Gleiche hinauslĂ€uft â wiederum der âcommon senseâ und die, die ihn âmachenâ, vor allem die Medien? Kann die so definierte Liebe MaĂstab fĂŒr ein christliches Leben und kirchliches Handeln sein?
NatĂŒrlich will man den Zeitgeist in den Kirchen nicht ungeprĂŒft zur Norm dessen erheben, was in der Kirche als verbindlich fĂŒr das Leben gelehrt wird. Man wird behaupten, daĂ eine verĂ€nderte Sicht sich auch aus einer kritischen Betrachtung der Bibel ergebe. Dabei unterscheidet man meist zwischen dem, was angeblich in der Bibel nur zeitbedingte und zeitgebundene Aussagen sind, die fĂŒr die Kirche in der Gegenwart nicht mehr verbindlich sein sollen, und Aussagen, die eine die Zeit ĂŒbergreifende Bedeutung haben, weil sie den heutigen Lebensauffassungen noch entsprechen. MaĂstab fĂŒr die Geltung der Heiligen Schrift wird dabei aber doch mehr oder weniger der gegenwĂ€rtige Lebenskontext und damit der âZeitgeistâ. Dabei verkennt man, daĂ es in der Heiligen Schrift keine Aussagen gibt, die nicht zeitbezogen sind. Aus dieser Zeitbezogenheit darf aber keinesfalls selbstverstĂ€ndlich eine Zeitgebundenheit, also eine beschrĂ€nkte Geltung der Aussagen nur im Kontext ihrer Entstehung gefolgert werden. Damit wĂŒrde die Genese einer Aussage mit ihrer Geltung verwechselt, wĂŒrde der Bezug auf die Bibel letztlich nur zur nachtrĂ€glichen Legitimation von Aussagen gebraucht, die bereits woanders, aber nicht aus der Heiligen Schrift selbst gewonnenen wurden. Mit dem reformatorischen âsola scripturaâ und der ihm entsprechenden Treue zur Heiligen Schrift, auch in der ethischen Urteilsbildung, hat dies nichts mehr zu tun. Diese Schrifttreue erweist sich allein darin, daĂ die gegenwĂ€rtige Bedeutung biblischer Aussagen im GesprĂ€ch mit der Heiligen Schrift entfaltet wird. In einem zweiten Schritt kann und muĂ dann auch danach gefragt werden, wie diese in der heutigen Zeit vermittelt und gelebt werden kann. Dazu bedarf es auch der Analyse der heutigen LebensverhĂ€ltnisse, ohne daĂ diese zum maĂgeblichen Horizont der Geltung der Aussagen der Heiligen Schrift gemacht werden. Nur bei dieser Rangfolge bleibt die Kirche dem âsola scripturaâ und damit ihrer Grundlage treu, auch in Fragen der Lebensformen der Geschlechter.
2. Bemerkungen zur Krise der Ehe in der Postmoderne
Seit den 1960-er Jahren hat sich ein Wandel der Lebenseinstellungen vollzogen, der als Zuwachs an individueller Selbstverwirklichung gekennzeichnet werden kann. Deren Kern bildet das Streben nach Autonomie und Befriedigung individueller BedĂŒrfnisse, insbesondere des BedĂŒrfnisses nach persönlichem GlĂŒck. Bindungen und Pflichten werden deshalb nur so weit bejaht, wie sie fĂŒr das eigene innere und Ă€uĂere Wohlergehen unmittelbar erforderlich sind, sie also im Dienste des Individuums und seines GlĂŒckes stehen. Das fĂŒhrte zur Krise der ĂŒberindividuellen, auf Verbindlichkeit ausgerichteten Lebensformen und Institutionen (z.B. Ehe). Die Sehnsucht nach GlĂŒck ist stark auf das GlĂŒck in der âLiebeâ ausgerichtet. In ihr erwartet der Mensch die ErfĂŒllung emotionaler BedĂŒrfnisse, die eine immer sachlichere Arbeits- und Lebenswelt kaum noch zu befriedigen vermag. Liebe – verstanden als subjektives GefĂŒhl der BeglĂŒckung hier und jetzt – wird zur âirdischen Religionâ. Dazu sind zwar personale Beziehungen nötig, aber nicht unbedingt solche dauerhafter Art. Wenn in Beziehungen die ErfĂŒllung solcher BedĂŒrfnisse gesucht, aber doch nicht gefunden wird, so fĂŒhrt das oft zum schnellen Partnerwechsel in der Hoffnung, daĂ der neue Partner die hohen Erwartungen emotionaler Art zu erfĂŒllen vermag. Menschen sind immer hĂ€ufiger eher bereit, ihre Partner zu wechseln, als die hohen subjektiven Erwartungen an Partnerbeziehungen zu revidieren. Dies fĂŒhrt zu einer allmĂ€hlichen Auflösung der Ehe durch das individualistische LiebesverstĂ€ndnis (E. Beck-Gernsheim). Wenn die âĂ€uĂereâ Lebensform derart gleichgĂŒltig wird, dann droht auch die innere Gestaltung der Lebensform und die Ausformung des Begriffs âLiebeâ in ihr beliebig zu werden. Es mĂŒssen dann letztlich alle Lebensweisen der Geschlechter gleichwertig werden, die die Betroffenen gemÀà ihrem rein subjektiven VerstĂ€ndnis mit dem Begriff âLiebeâ qualifizieren.
Neben der Suche nach GlĂŒck ist das Streben nach Autonomie das zweite Grundanliegen des angedeuteten Wertewandels. Ehe, als dauerhafte Lebensgemeinschaft, und das Streben nach autonomer Selbstverwirklichung stehen in einem spannungsvollen VerhĂ€ltnis zueinander. Als die Ehe noch die einzige sozial anerkannte Lebensform der Geschlechter war, wurde eine vorgegebene Ehesituation hingenommen, auch wenn sie fĂŒr die Partner nicht befriedigend war, wenigstens, so lange sie nicht unertrĂ€glich wurde. Heute wird die Ehe jedoch daraufhin geprĂŒft, ob sie die Lebensform ist, die die ErfĂŒllung des Strebens nach GlĂŒck am meisten garantiert und doch zugleich dem BedĂŒrfnis nach autonomer Selbstverwirklichung nicht im Wege steht. Wenn das Streben nach GlĂŒck unter Wahrung der eigenen Autonomie eindeutigen Vorrang gegenĂŒber dem gemeinsamen Leben bekommt, dann fĂŒhrt das schnell zu der Lebensmaxime: Beziehung âjaâ, Bindung auf Dauer âneinâ, dann kann das gemeinsame Leben diesem Streben nach GlĂŒck schnell geopfert werden. Die mehr oder weniger enge Beziehung wird zwar zur eigenen Bereicherung gewĂŒnscht, kann aber aufgelöst werden, wenn die sich wandelnden individuellen BedĂŒrfnisse als âSingleâ oder mit einem anderen Partner oder in einer anderen Lebensform besser befriedigt werden können. Mit der gekennzeichneten âGefĂŒhlsliebeâ lĂ€Ăt sich das Streben nach Autonomie viel besser vereinen als mit einer auf Dauer ausgerichteten und lebenslange Verantwortung fĂŒreinander ĂŒbernehmenden Liebes- und Lebensgemeinschaft (Ehe). Die Auswirkungen dieser verĂ€nderten Lebenseinstellungen auf die Institutionen Ehe, Familie und das VerhĂ€ltnis der Generationen zueinander sind unverkennbar (abnehmende Zahl der EheschlieĂungen, stetig zunehmende Zahl der Ehescheidungen, seelische Belastungen, vor allem fĂŒr Kinder, Bedrohung des Generationenvertrags u.a.).
3. Grundlegende theologische Fragen im Streit
um die Bedeutung der Ehe
Unsere AusfĂŒhrungen machen deutlich, daĂ im Streit um die Ehe grundsĂ€tzliche theologische Fragen zur Diskussion stehen, in erster Linie das VerstĂ€ndnis von Liebe und der âFreiheit eines Christenmenschenâ und dann die Bedeutung der göttlichen Gebote und Lebensordnungen.
3.1. âLiebeâ und Ehe
Beziehungen, die primĂ€r auf dem postmodernen VerstĂ€ndnis von Liebe basieren, reichen entsprechend nur soweit, wie die GefĂŒhle tragen. Diese Auffassung von Liebe steht in einem kaum zu versöhnenden Widerspruch zum christlichen VerstĂ€ndnis. Man hat in der theologischen Tradition zum Teil einen scharfen Gegensatz zwischen dem herausgestellt, was in der Bibel mit dem Begriff âAgapeâ (1 Kor 13) und was in der heidnisch-griechischen Welt mit dem Begriff âErosâ bezeichnet wird. M. Luther fĂŒhrte in der 28. These der Heidelberger Disputation aus, daĂ die Liebe des Menschen das liebt, was er als fĂŒr sich wertvoll und liebenswert vorfindet, Gottes Liebe jedoch schaffe sich ihren Gegenstand, mache ihn erst wertvoll, indem sie ihn liebt. Der âErosâ sucht danach nicht wirklich den NĂ€chsten als Person, sondern nur sofern er fĂŒr mich einen Wert darstellt, er als Mittel zur eigenen GlĂŒckserfĂŒllung gebraucht werden kann. Auch wenn diese idealtypische Entgegensetzung von Eros und Agape so nicht haltbar ist, bleibt doch unverkennbar, daĂ zwischen beiden ein spannungsvolles VerhĂ€ltnis besteht, daĂ der Eros immer in Versuchung steht, das âSeineâ zu suchen (vgl. Tobias 8, 7ff., 1 Kor 13, 5).
Das biblische VerstĂ€ndnis von âAgapeâ ist eingeordnet in Beziehungen von Menschen, in denen es um das dauerhafte Gelingen dieser Lebensbeziehungen in guten und bösen Tagen und damit um die Treue zueinander geht. Der âErosâ ist in den Dienst der dauerhaften Bindung und Beziehung gestellt, einer Liebesgemeinschaft, die zugleich eine dauerhafte Lebensgemeinschaft bildet. Sie wird freilich um so eher geschenkt sein, je tiefer beglĂŒckende und lustvolle Augenblicke innerhalb einer auf Dauer ausgerichteten Lebensgemeinschaft gelingen. Wenn die Propheten des Alten Testaments die âEheâ als âGleichnisâ fĂŒr den Bund des einen Gottes mit dem von ihm erwĂ€hlten einen Volk verwenden, so setzen sie fĂŒr ihre Zeit bereits die monogame lebenslange Ehe voraus, denn sonst hĂ€tte sich die Ehe nicht als irdisches Gleichnis fĂŒr das exklusive VerhĂ€ltnis Gottes zu seinem erwĂ€hlten Volk geeignet. Zugleich wird durch diese theologische Sicht die monogame Ehe tiefer begrĂŒndet, sie wird zur einzigen dem Gottesglauben Israels entsprechenden Lebensform der Geschlechter (Mal 2,10 ff; Spr. 2,17; Hosea 1 u. 2).
Diese Vorstellung vom âBundâ wurde leitend fĂŒr das christliche VerstĂ€ndnis vom âEhebundâ (Eph 5,21 ff). Dementsprechend ist die Liebe nicht primĂ€r ein subjektives GefĂŒhl, sondern ein Beziehungsgeschehen zwischen Partnern. Die Liebe achtet den Partner wie sich selbst, nimmt so die Gestalt der Sorge fĂŒr den anderen und der Bereitschaft an, fĂŒr ihn einzustehen (1.Kor 13,7). Aus dem Miteinander der Partner soll also ein FĂŒreinander werden. Diese Liebe ĂŒbernimmt so Verantwortung fĂŒr den Partner und die aus der Partnerschaft hervorgehenden Kinder. Indem die Liebe die Gestalt der Sorge fĂŒreinander annimmt, wird das reale Leben mit seinen Konflikten in das VerstĂ€ndnis der ehelichen Liebe integriert. EntschluĂ zur Ehe bedeutet also, daĂ die Partner dem âWirâ, dem gemeinsamen Leben den Vorrang vor der eigenen Selbstverwirklichung geben und damit ihre eigene Freiheit dem Gelingen der Beziehung ein- und unterordnen. In eindrĂŒcklicher Weise hat M. Luther dieses VerstĂ€ndnis âVon der âFreiheit eines Christenmenschenâ (1525) entfaltet. Freiheit ist fĂŒr ihn nicht Autonomie, sondern immer neu bewĂ€hrte Befreiung des Menschen von sich selbst in der Bindung an Gott im Glauben und darin zugleich Befreiung zur Liebe, zum Dienst am NĂ€chsten.
3.2. Die Ehe als von Gott gewĂ€hrte âlebensdienlicheâ
Lebensform der Geschlechter
In der Vorstellung vom Bund Gottes mit dem Menschen ist das Moment der Treue, des UnverbrĂŒchlichen der liebenden Zuwendung Gottes zum Menschen unabdingbar mitgesetzt. Sie wird deshalb auch fĂŒr die eheliche Lebensgemeinschaft geltend gemacht (Hosea 1 u. 2; Mal 2,15 f.; Spr.2,17). Liebe, die ohne ganzheitliche Treue ist, erfaĂt nicht das ganze Leben in seiner zeitlichen Erstreckung, als Aufstieg und Abstieg körperlicher und psychischer AttraktivitĂ€t, als GlĂŒck und Entsagung (vgl. Tobias 8,7f.). Die Treue bringt in das VerstĂ€ndnis von Liebe neben der Sorge fĂŒreinander das zeitliche Moment, die lebenslange Dauer ein. Beide zusammen sind konstitutive Momente dessen, was wir als Verantwortung fĂŒreinander aus Liebe bezeichnen. Zum Gelingen des Lebens in der Liebe gehört also unabdingbar, einander zur Freude zu verhelfen und im Leiden zu helfen. Ein christliches VerstĂ€ndnis von GlĂŒck und Liebe schlieĂt das gesamte Leben mit seinen Höhen und Tiefen und mit den MĂŒhen um BestĂ€ndigkeit ein. âDie groĂe Liebe erkennt man nicht an ihrer (momentanen) StĂ€rke, sondern an ihrer Dauerâ (Robert Poulet). Diese Liebe macht aus der Liebesgemeinschaft erst eine Lebensgemeinschaft, die in Freude und Leiden gelingen kann. Insofern kann man â mit Karl Barth â sagen, daĂ die Ehe das erste und exemplarische Lebensfeld ist, in dem sich der Glaube in der Liebe zu bewĂ€hren hat. Die Liebe ist nach christlicher Sicht kein inhaltsloser Begriff, den die Partner beliebig fĂŒllen können. Sie meint ein Beziehungsgeschehen, richtet sich also zunĂ€chst auf das gemeinsame Leben aus. âLiebeâ steht demnach zu den auf das Gelingen des Lebens zielenden, von Gott geschenkten Lebensordnungen und seinen Geboten nicht im Widerspruch, sie bewirkt nicht deren Auflösung, sondern ihre ErfĂŒllung (Röm 13,9; Gal 5,14; 6,2; Mt 5,17ff.; Joh 14,15; 1 Joh 5,2.17 ff.). Die Gebote Gottes sind Angebote heilsamer Grenzen und SpielrĂ€ume menschlicher Freiheit, Angebote lebensdienlicher Ordnungen des Lebens, in denen sich die Liebe in der Verantwortung fĂŒr das eigene und das Leben anderer zu bewĂ€hren hat.
Die âĂ€uĂere Formâ der Beziehungen der Geschlechter, die Ehe, dient also dem Gelingen ihrer âinnerenâ Gestaltung, ihrer von Gott gewollten Bestimmung. Dabei ist nicht nur das personale Leben der Ehepartner im Blick, sondern das ihr Leben ĂŒbergreifende und ermöglichende gemeinschaftliche Leben, insbesondere das Zusammenleben der Generationen. Gerade die Ehe, die sich zur Familie weitet, nimmt diese die Generationen ĂŒbergreifende Verantwortung war. Die irrige Behauptung, daĂ zu einem evangelischen VerstĂ€ndnis der Ehe die grundsĂ€tzliche Bereitschaft zum Kind nicht konstitutiv hinzugehört, ist die Folge einer falschen antikatholischen Frontstellung, sie wurde aber von der EKD unter dem Eindruck der demographischen Entwicklung zu recht eindeutig widerrufen (vgl. EKD Studie, Gottes Gabe und die persönliche Verantwortung. Zur ethischen Orientierung fĂŒr das Zusammenleben in Ehe und Familie, 1998). Die Familie erweist sich als die grundlegende âlebensdienlicheâ Lebensform, in der der einzelne in erster Linie Verantwortung fĂŒr die gröĂeren LebenszusammenhĂ€nge, fĂŒr die vorangehenden wie auch die nachfolgenden Generationen, fĂŒr Kinder und alte, kranke und pflegebedĂŒrftige Menschen wahrnimmt. Zu Recht bezeichnet die EKD-Studie daher die Lebensdienlichkeit als das entscheidende sozialethische Kriterium fĂŒr das Zusammenleben der Geschlechter, dem letztlich nur die Ehe, die sich zur Familie weitet, entspricht. Wer sich bewuĂt gegen Kinder entscheidet, obwohl er sie natĂŒrlicherweise empfangen könnte, entscheidet nicht nur, daĂ die Menschheit in seiner Person ein Ende nimmt, sondern verweigert den entscheidenden Beitrag zum Gelingen eines gemeinschaftlichen Lebens.
SchluĂfolgerung
Sollte sich auch die Kirche von der Ehe als normatives Leitbild des Zusammenlebens der Geschlechter verabschieden, sie als âauslaufendes Modellâ behandeln? Das kann doch nur der Fall sein, wenn es vordringliche kirchliche Aufgabe ist, auf den Dampfer des gesellschaftlichen âFortschrittsâ noch rechtzeitig aufzuspringen, um seine Fahrtrichtung âabzusegnenâ. So wird die Kirche zu einer âInstanzâ, die den Pluralismus der Lebensweisen in unserer Gesellschaft religiös legitimiert und ihn selbst â wenn auch mit einer gegenĂŒber der Gesellschaft etwas verringerten Bandbreite â abbildet, sich dabei aber zunehmend selbst aufgibt und nicht begreift, daĂ die sĂ€kulare Gesellschaft dieser kirchlichen Legitimation letztlich gar nicht mehr bedarf. Unsere AusfĂŒhrungen zeigen, daĂ die Ehe in biblisch-theologischer Sicht eine zentrale, den VerheiĂungen Gottes fĂŒr das Leben entsprechende Bedeutung hat als primĂ€res BewĂ€hrungsfeld des Glaubens an die Liebe und Treue Gottes in dem menschlichen Leben, und daĂ sie zugleich eine entscheidende sozialethische Bedeutung hat als lebensdienliche Lebensform fĂŒr das Gelingen des gemeinschaftlichen Lebens in der SolidaritĂ€t des Generationenzusammenhangs. Sollte es nicht primĂ€re Aufgabe der Kirche sein, einer sĂ€kularen Gesellschaft die Ehe, die sich zur Familie weitet, als von Gott angebotene âheilsameâ und âlebensdienlicheâ Form des Zusammenlebens der Geschlechter weiterhin anzubieten? Das mĂŒĂte natĂŒrlich bedeuten, daĂ die Kirchen dies in ihren Lebensordnungen, nicht zuletzt auch fĂŒr das Leben der Pfarrerinnen und Pfarrer, verdeutlichen und fĂŒr verbindlich erklĂ€ren.
Prof. Dr. Ulrich Eibach, Auf dem Heidgen 40, 53127 Bonn
Literatur des Verfassers
Liebe, GlĂŒck und Partnerschaft. SexualitĂ€t und Familie im Wertewandel, 1996
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Freitag 15. Oktober 2004 um 10:18 und abgelegt unter Ehe u. Familie, Sexualethik.