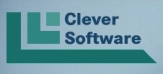Festvortrag: 500 Jahre Reformation – 10 Jahre Internationale Martin Luther Stiftung
Montag 9. April 2018 von Dr. Michael J. Inacker

Hier an diesem fĂŒr uns Protestanten heiligen Ort, auf der Wartburg, mit dem kraftvollen Redner Luther im RĂŒcken den Festvortrag zu halten, ist nicht einfach. Aber wir sind als Luther-Stiftung natĂŒrlich bewusst in diesem Jahr hierhin gegangen â 500 Jahre Reformation und â etwas bescheidener â 10 Jahre Luther Stiftung: Das ist Anlass fĂŒr die Veranstaltung hier, und dass wir mit einer Regel gebrochen haben: Den Festvortrag hĂ€lt kein Ehrengast, sondern der Vorsitzende der Stiftung.
Vor allem den Bogen von der Reformation hin zu den aktuellen Entwicklungen in Deutschland zu schlagen, ist nicht einfach. Luther wird ja fĂŒr Vieles in Anspruch genommen â inzwischen ja schon auch fĂŒr das Erstarken der AfD. Geschichtliche Vereinfacher gibt es ja genug. Und die Versuche, von Luther ĂŒber Friedrich den GroĂen, Bismarck eine Linie bis zu Hitler und dem Holocaust zu ziehen, musste der arme Luther auch in diesem Jahr ĂŒber sich ergehen lassen. Und wissen Sie, was das Schöne daran ist? Luther wird auch das ĂŒberleben.
Ich will also versuchen, einen weiten historischen Bogen zu schlagen, nochmal an das erinnern, was die Reformation ausmacht, heute bedeutet und wie es sich mit dem Land der Deutschen derzeit verhÀlt.
Wirkliche Revolutionen beginnen mit der Art und Weise, wie wir Dinge betrachten, wenn uns die Augen geöffnet werden. Und das hat Luther getan. Er hat den Menschen vor 500 Jahren die Augen geöffnet fĂŒr die UnmĂŒndigkeit, in der sie sich befanden, nĂ€mlich GlaubenssĂ€tze einfach ungeprĂŒft als Vorgaben von oben â sei es durch die damalige Kirche, sei es durch damaligen Herrscher â zu ĂŒbernehmen.
Ohne Luther keine Reformation. Ohne Reformation keine RĂŒckfĂŒhrung des Glaubens auf den Kern von Gnade und der Schrift. Und ohne diesen Kern keine evangelische Kirche â lutherisch, reformiert oder uniert. Und ohne evangelische Kirche keine starke katholische Kirche. Der Wettbewerb hat die Christen belebt, die Katholiken am Ende zur Selbsterkenntnis gebracht.
Und wir Protestanten können uns nicht â selbst wenn wir wollten â seiner fortdauernden Kraft entziehen. Es gibt eine interessante wissenschaftliche Disziplin â die Religionssoziologie -, die untersucht, wie religiöse Traditionen in uns fortwirken â selbst 500 Jahre spĂ€ter, und auch selbst dann, wenn sich einzelne von ihrer Kirche losgesagt haben.
Einer der bedeutendsten Religionssoziologen, Gerhardt Schmidtchen, hat in seinem Buch âProtestanten und Katholikenâ ein wunderschönes Beispiel dafĂŒr benannt: Einige von Ihnen kennen bestimmt noch die Zigaretten-Marke âPeter Stuyvesantâ. Diese wurde in den 70er und 80er Jahr von deutlich mehr Protestanten als Katholiken geraucht. Woran lag das? Auf der Packung war schlieĂlich nicht das Gesicht von Martin Luther abgebildet. Die ErklĂ€rung ist ĂŒberraschend â weil sie die Wirkungsmacht religiöser PrĂ€gung selbst beim Zigarettenkonsum zeigt. Evangelische Christen sind reisefreudiger als ihre katholischen BrĂŒder. Das hĂ€ngt damit zusammen, dass die Welt des Protestanten eine offene, nicht strukturierte Welt ist. Wir haben kein Lehramt, keinen Papst, keine KardinĂ€le, selbst das Wort âBischofâ scheuen wir und sprechen lieber vom âPrĂ€sesâ. Der Protestant ist nicht festgenagelt auf seine Position. Er reist gerne, entdeckt die Welt, bricht zu neuen Ufern auf. Kein Wunder, dass sich deshalb Protestanten vom Slogan von Peter Stuyvesant besonders angezogen fĂŒhlten: Die Zigarette warb mit dem âDuft der groĂen weiten Weltâ, und das hat die Protestanten neugierig gemacht.
Dies mag uns heute vielleicht amĂŒsieren. Doch andere Eigenschaften sind ebenfalls prĂ€gend fĂŒr evangelische Christen – und jetzt wird es ernster: Sparsamkeit, GeschĂ€ftsklugheit und das VerstĂ€ndnis vom Beruf als Berufung. Was wir Protestanten machen, machen wir perfekt. Allerdings auch mit dem Risiko, dass Beruf und Erwerb Selbstzweck werden. Pointiert könnte man sagen: Wir Protestanten leben, um zu arbeiten. Wir arbeiten aber nicht, um zu leben.
Diese PrĂ€gung besteht bis heute fort, auch wenn sich die westliche Welt immer weiter sĂ€kularisiert. Bis in die aktuelle Euro-Krise lĂ€sst sich erkennen, dass es eine nĂ€here Beziehung von Protestantismus und Wirtschaft gibt. So ist es beispielsweise auffĂ€llig, dass die Euro-Krise eher den katholisch oder orthodox geprĂ€gten SĂŒden Europas mit Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal betrifft, wĂ€hrend der protestantische Norden mit Deutschland, den Niederlanden und den skandinavischen LĂ€ndern wirtschaftlich besser und weniger verschuldet dasteht. Diese wirtschaftliche Diskrepanz lĂ€sst sich im Ăbrigen auch fĂŒr das katholische SĂŒdamerika beobachten. Und um es zu vervollstĂ€ndigen: Dieser Unterschied lĂ€sst sich auch in Nordrhein-Westfalen beobachten. Die Auswertungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform, die unter anderem die KreditwĂŒrdigkeit von Unternehmen analysiert, zeigen, dass die Unternehmen entlang der katholischen Rheinschiene einen höheren Verschuldungsgrad haben als im evangelisch geprĂ€gten Westfalen und Bergischen Land.
Warum nenne ich diese Beispiele? Weil das lutherische Wirken sehr lebendig ist. Luther lebt. Auch wenn er gerne, leider auch in unserer Kirche, als Mann fĂŒr das Museum gesehen wird. Dort möchten ihn viele am liebsten verstecken. Aber es ist so wie in dem Hollywood-Film âNacht im Museumâ – wenn wir, wenn Sie genau hinschauen, dann zwinkert Luther Ihnen zu und bittet darum, aus der Glasvitrine hervorgeholt zu werden. Luther ist kein Mann fĂŒrs Museum, er ist ein Mann fĂŒrs Leben. FĂŒr unser Leben zwischen privatem GlĂŒck und Leid, Euro-Krise, FlĂŒchtlingskrise und Terrorkrise.
Wer Luther naht, wird vom Leben berĂŒhrt: Luther – der Reformator, evangelische Kirchenvater, Augustiner-Mönch, Mensch im Ringen mit den Anfechtungen seiner Zeit und mit den politischen MĂ€chten, Mittler zwischen Mittelalter und Neuzeit. Seine Impulse aus Freiheitsdrang, Vernunft und fundamentalem Gottvertrauen wirken bis heute fort.
Luther ist und bleibt fĂŒr uns Protestanten eine feste Burg. Er ist das Gegenteil von Zeitgeist-Orientierung, also ganz anders als Teile der evangelischen Kirche in der Vergangenheit und Zukunft.
Freiheit war fĂŒr Luther nie ungebunden, sondern immer gepaart mit Verantwortung. In seiner berĂŒhmten Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen schreibt Luther: âEin Christenmensch ist ein freier Herr ĂŒber alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.â Dieser Auftrag an uns, seine Theologie, sein GrundverstĂ€ndnis von der Freiheit eines Christenmenschen, entfalten bis heute eine ungeheure Wucht.
Ohne Luther wĂ€re die Moderne nicht denkbar, er stand am Beginn der Neuzeit. Er hat die Freiheit – die die damalige Institution Kirche fĂŒr sich nach auĂen gerne in Anspruch nahm, nach Innen aber verweigerte – dem einzelnen Menschen zurĂŒckgegeben.
Und das Vernunftprinzip hat er eingefĂŒhrt. Auf dem Wormser Reichstag wollte er sich nur widerlegen lassen durch âZeugnisse der Schriftâ oder âklare VernunftgrĂŒndeâ.
Freiheit, Verantwortung und Erkenntnis – das war von nun an etwas, das der glĂ€ubige Mensch mit sich und Gott ausmachen konnte. Oder, wie es der Historiker Thomas Nipperdey einmal formulierte: âDie GĂŒltigkeit religiöser und ethischer Normen, die der einzelne Mensch akzeptiert, wird von ihm selber durch seine Zustimmung erzeugt.â
Der Mensch war nicht mehr ein Spielball fremder MĂ€chte â gleichgĂŒltig ob in Politik, Wirtschaft oder Kirche. Er bestimmte mit, wurde aktiv. Deshalb standen Protestanten (ich sage bewusst nicht die evangelischen Kirchen) an vorderster Front fĂŒr die Durchsetzung von Demokratie und einem freien Unternehmertum, das sich aber seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst war. Die Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft wurden von bewussten evangelischen Christen im Widerstand gegen die Nazi-Diktatur gelegt. Und so ergab sich, dass unsere freiheitliche Demokratie in der sozialen Marktwirtschaft ihre wirtschaftliche ErgĂ€nzung gefunden hat. Eine Wirtschaftsordnung â mit allen Defiziten â die auf sozialen Ausgleich und Arbeitnehmer-Mitwirkung bei gleichzeitiger Leistungs- und Gewinnorientierung setzt, hat mit ihrem Erfolg viel dazu beigetragen, um den zweiten demokratischen Versuch nach Weimar in Deutschland zu verankern. Und auch der demokratische Umbruch in der DDR wurde vielfach aus den evangelischen Kirchen herausgetragen. Viele Pfarrer oder Pfarrerskinder gingen in die Politik. Bis vor kurzem hatten wir noch einen evangelischen Pfarrer als BundesprĂ€sidenten und eine Pfarrerstochter als Kanzlerin.
Ăberhaupt das evangelische Pfarrhaus: Es hat den Protestantismus stark gemacht. Ihm verdanken wir protestantische Persönlichkeiten, die, ausgerĂŒstet mit einem Rucksack aus Werten, Ăberzeugungen und dem Anspruch zur Gestaltung und gepaart mit christlich-lutherischer Verantwortungsethik, ihre jeweiligen Bereiche verĂ€ndert haben. Aus diesem besonderen Eltern- und Glaubenshaus sind Wissenschaftler, Ingenieure, Banker, Journalisten, Bischöfe, Terroristen, Unternehmer und Politiker hervorgegangen. Das Pfarrhaus und die dort lebende Pfarrerfamilie haben wie LeuchttĂŒrme gewirkt. Gerade in dunklen oder trĂŒben Zeiten gesellschaftlicher Entwicklung in Deutschland und auch anderen protestantisch geprĂ€gten LĂ€ndern ist die Strahlkraft des Pfarrhauses von besonderer Bedeutung gewesen.
Allerdings â auch dies gehört zur historischen Wahrheit – die evangelische Kirche selbst hat in den Jahrhunderten Ihrer Existenz diese Potenzial nicht nur nicht genutzt, sondern manchmal auch verdrĂ€ngt. Heute kaum vorstellbar, aber bis 1945 gehörte die evangelische Kirche eher zu den MĂ€chten, die die Demokratie ablehnten als förderten. Und gerade Protestanten sind zu allen Zeiten dankbare Abnehmer politischer Heilslehren gewesen â gleichgĂŒltig ob von ganz rechts oder ganz links. Und hier ist unsere groĂe lutherische Herausforderung. Die Freiheit, Verantwortung zu ĂŒbernehmen und selbstĂ€ndig zur Erkenntnis von Gut und Böse zu kommen, sind Lust und Last zugleich.
Papier statt Papst, also lesen, nachdenken, studieren anstelle Vorgaben aus Rom einfach abzunicken, diese intellektuelle VerĂ€nderung setzt eine starke, unbestechliche und unabhĂ€ngige Persönlichkeit voraus. Denn gerade wegen des Wegfalls von starken Institutionen â wie schon gesagt, kein Lehramt und kein Papst, der einem klare Weisung gibt, stattdessen das Priestertum aller GlĂ€ubigen â benötigt der Protestant einen starken und unabhĂ€ngigen Charakter. Ansonsten droht die AnfĂ€lligkeit permanent nach innerweltlichen Ersatzstrukturen zu suchen, die dem Protestanten dann jenen festen Halt geben, den die Katholiken in ihrer Kirche und dem Lehramt haben.
Auch hier gibt es ein interessantes Beispiel aus der Religionssoziologie: Protestantische Frauen neigen dazu âPutzteufelâ zu sein, Ordnung zu ĂŒbertreiben. Warum ist es so? Jemand, der sich durch seine Konfession, seinen Glauben in die Welt geworfen sieht, mitunter allein gelassen fĂŒhlt mit sich und Gott, der sucht Ersatz. Und sei es nur dadurch, dass er fĂŒr alles zu Hause Ordnung und Sauberkeit braucht, weil er das Unklare, das UngefĂ€hre, das Unordentliche nicht ertragen kann.
Heute denkt die Kirche â ein wenig selbstgefĂ€llig â sie hĂ€tte die Verfehlungen und Irrungen frĂŒherer Jahrhunderte abgestreift. Doch auch heute passen sich einige von Luthers Nachfolgern nur zu bereitwillig den Strömungen der Zeit an. Die evangelische Kirche bildet in ihrer FunktionĂ€rs-Struktur schon lange nicht mehr die Breite der evangelischen Christen ab. Bitte nicht falsch verstehen: Ich will auch keine CDU-Kirche, aber die weitverbreitete Doppelfunktion von SPD und GrĂŒnen ParteifunktionĂ€ren in kirchlichen Gremien von Synoden bis Kirchentagen ist auffĂ€llig und macht die evangelische Kirche langweilig, berechenbar und einseitig â und damit auch unattraktiv als Burg unseres Glaubens. Viele Stellungnahmen atmen heute den rot-grĂŒnen Zeitgeist. Der Reformator Luther hingegen hatte einen klaren Kompass. âHier stehe ich und kann nicht andersâ, soll er im Angesicht einer möglichen Todesstrafe auf dem Wormser Reichstag gesagt haben.
Sehr geehrte Damen und Herren,
âReligion hat Kraftâ, so hat es der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm jĂŒngst formuliert. Der Bischof hat leider nicht Recht. Die christliche Religion in Deutschland hat keine Kraft. Und ihre SchwĂ€che ist die StĂ€rke des Islam. Ein Land, dessen Kirchen voll wĂ€ren, dessen BĂŒrger um ihre christliche IdentitĂ€t wĂŒssten, brĂ€uchte selbst bei einer Million FlĂŒchtlinge sich nicht Bange machen zu lassen. Doch wegen der Selbstvergessenheit von Politik und KirchenfunktionĂ€ren wird die FlĂŒchtlingskrise die Entchristlichung Deutschlands beschleunigen. Das VerschlieĂen der Augen vor diesen Folgen einer islamisch dominierten Völkerwanderung, versteckt unter falsch verstandener christlicher Toleranz, verĂ€ndert das Land. âDeutschland wird muslimischerâ, formuliert selbst der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber in der âSĂŒddeutschen Zeitungâ und ergĂ€nzt, âeine indifferente Toleranz fĂŒhrt dabei nicht weiterâ. Religion sei zwar persönlich, aber immer auch öffentlich. Gerade deshalb werden Religionskonflikte erst dann ĂŒberwunden, wenn Religion nicht zur HerabwĂŒrdigung oder UnterdrĂŒckung anderer missbraucht wird.
Das Christentum hat durch AufklĂ€rung und SĂ€kularisierung gelernt. Diesen Strömungen gegenĂŒber haben sich aber gewichtige Teile des Islam verschlossen. Fundamentalistische Muslime sind Teil der Völkerwanderung, die jetzt in unser Land kommt. Auch christliche FlĂŒchtlinge sind darunter, diese fĂŒrchten aber teilweise um ihr Leben. Die normale Antwort wĂ€re Abgrenzung gegen solche KrĂ€fte und deren Ausweisung.
Doch Politik und Teile der Kirchen geben die falsche Antwort. Weil man sich an die Ursache, unkontrollierte Zuwanderung, nicht herantraut, werden Spielregeln und Werte, auch die christlichen Werte, unserer freiheitlichen Demokratie aufs Spiel gesetzt. Um die Kraft des Islams zu besĂ€nftigen, setzt man nicht auf den starken Staat, sondern auf Laizismus â die ZurĂŒckdrĂ€ngung jeder Religion in der Ăffentlichkeit. Das aber, meine Damen und Herren, wird die christliche Religion hĂ€rter treffen als den Islam. Bereits im FrĂŒhjahr hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Kopftuch-Urteil festgelegt, dass eine Privilegierung des christlichen Glaubens im öffentlichen Raum nicht der Verfassung und Religionsfreiheit entspricht.
Die Kirchen haben das Urteil verschlafen. Kirchengegner, aber auch muslimische Gemeinschaften, haben jetzt einen immer stÀrkeren Hebel gegen die hervorgehobene öffentliche Stellung des christlichen Glaubens. In der brandenburgischen Landesregierung wurde selbst Sternsingern der Zutritt verweigert, weil dies angeblich nicht mit der ReligionsneutralitÀt vereinbar sei.
Um den immer gröĂeren Anteil von Muslimen zu befrieden, werden die Kirchen relativiert â im Kanzleramt wird bereits zum Fastenbrechen am Ende des Ramadans eingeladen. Deutschland ist tolerant und ist es auch gegenĂŒber Muslimen. Toleranz heiĂt aber nicht Selbstaufgabe. Und der Prozess setzt sich fortâŠ
Das jĂŒngste Beispiel kommt aus der deutschen Wirtschaft. Eines der gröĂten Handelsunternehmen Europas, Lidl, von der in Baden-WĂŒrttemberg ansĂ€ssigen Schwarz-Gruppe, spielt mit dem wichtigsten Symbol der Christenheit aus vorauseilendem Gehorsam Versteck. Das Unternehmen hat in mehreren LĂ€ndern auf Verpackungen seiner Marke âEridanousâ mit griechischen Produkten â etwa Bifteki, Feta und Tzatziki, Kreuze wegretuschiert. Die Antwort des Unternehmens auf Anfrage von Kunden sowie von Idea fallen wenig ĂŒberzeugend aus: Weder eine politische noch religiöse âParteinahmeâ sei fĂŒr das Unternehmen ârelevantâ. Nun hat man zwar keine Partei genommen â was der Fall wĂ€re, wenn man religiöse Symbole, die vorher nicht da waren, hinzugefĂŒgt hĂ€tte. Aber auch eine Parteiverleugnung ist letztlich Parteinahme â eine negative oder eine Parteinahme fĂŒr die Kritiker und Gegner des Kreuzes.
Wer die christliche Symbolik wegretuschiert oder versteckt, der drĂŒckt damit auch etwas aus, nĂ€mlich seine Angst davor, die Werte und GrundsĂ€tze Europas und Deutschlands zu achten. In dem Fall ist die vermeintliche Angst, dass sich Nicht-Christen von Kreuzen auf KĂ€severpackungen verletzt fĂŒhlen könnten und dem Unternehmen Lidl Schwierigkeiten machten, offenbar gröĂer als die Angst vor christlichen Kunden, die sich enttĂ€uscht abwenden.
Zwar hat das Unternehmen inzwischen seine Entscheidung korrigiert. Doch sagt dieser Vorgang an sich viel aus: Erstens ĂŒber das Management und die EigentĂŒmer bei dem Discounter aus Neckarsulm. Dass Wertschöpfung auch Werte voraussetzt, ist dort in Vergessenheit geraten. Dass Unternehmen immer auch gesellschaftliche Verantwortung tragen und dass der Horizont ĂŒber das reine Geldverdienen hinausgeht, wird an Management-Schools und UniversitĂ€ten offenbar nicht berĂŒcksichtigt.
Zweitens aber zeigt sich wie groĂ inzwischen die Angst in unserer Gesellschaft vor dem Islam und seinem extremistischen Ableger ist. GleichgĂŒltig, ob deutsche KaufhĂ€user Produkte aus Israel aus dem Sortiment nehmen oder eben Kreuze verstecken â Ursache sind Sorge, Kleinmut und vorauseilender Gehorsam. Es stimmt eben schon lange nicht mehr die Floskel unserer Regierungen, die nach jedem Terroranschlag ausgesprochen wird, dass wir unsere Lebensweise und Werte nicht aufgeben. Wir sind lĂ€ngst dabei â unsere Freiheit und unser Glaube sind auf dem RĂŒckzug.
NatĂŒrlich gibt es keine christlichen Unternehmen â genauso wenig wie es einen christlichen Staat gibt, aber unsere Verfassung, die Werte unserer Gesellschaftlich sind und bleiben christlich geprĂ€gt. Wenn in Deutschland und Europa, also gemeinhin dem christlichen Abendland, die eigenen Werte, religiösen Traditionen und Symbole nicht mehr geachtet, sondern verborgen werden, dann verlieren auch die Muslime den Respekt vor unserer Kultur. In welche Gesellschaft und Wertvorstellungen hinein soll dann Integration ĂŒberhaupt noch gelingen?
Ich wiederhole: Die SchwĂ€che des Christentums ist die StĂ€rke des Islam. Wir brauchen nicht ĂŒber die wachsende Dominanz des Islams zu klagen, wenn das christliche Abendland und seine Gesellschaften, einschlieĂlich der sie tragenden Institutionen, permanent auf dem RĂŒckzug sind.
Die Kirche Luthers hat gegen diesen Prozess keine Strategie â weder gegenĂŒber den Gerichten, noch gegenĂŒber Politik und Gesellschaft. Und die CDU fĂ€llt als Partner aus, weil ihre Politik, die Politik einer C-Partei, mitverantwortlich fĂŒr die weitere Entchristlichung ist.
Sehr geehrte Damen und Herren,
die konstante Schrumpfung der Kirchen in den freiheitlich-demokratisch verfassten Wohlstandsgesellschaften der westlichen Welt lĂ€sst bisweilen gar an ein âEnde des Christentums in Europaâ (Eberhard von Gemmingen) denken. Diese Szenarien hat jĂŒngst der katholische Politikwissenschaftler Andreas PĂŒttmann umfassend beschrieben, und ich will diese an dieser Stelle zusammenfassen: Zwar mag die Warnung vor dem Ende des Christentums in Europa voreilig sein angesichts der unwĂ€gbaren ZeitlĂ€ufe, die dem tradierten Glauben durchaus wieder Zulauf verschaffen könnten, und ĂŒbertrieben im Blick auf seine immer noch eindrucksvollen Ressourcen sozialer Wirksamkeit, von der globalen, in Afrika und Asien wachsenden Bedeutung der christlichen Religion ganz zu schweigen. Doch tut man gut daran, so sagt PĂŒttmann, sich fĂŒr das eher pessimistische Regionalszenario zu wappnen: geistlich, organisatorisch und auch psychologisch. Denn Meinungsminderheiten neigen dazu, sich weniger zu ihren Ăberzeugungen zu bekennen, wĂ€hrend die wahrgenommene Mehrheit sich umso ungehemmter exponiert und so noch ĂŒbermĂ€chtiger erscheinen kann als sie tatsĂ€chlich ist, so die empirisch gestĂŒtzte Theorie der âSchweigespiraleâ der deutschen Soziologin Elisabeth Noelle. Insofern könnte sich der AbwĂ€rtstrend sozialpsychologisch beschleunigen. Das Glaubensleben ist nĂ€mlich auch ein âgruppendynamischer Prozessâ (Renate Köcher).
In weiten Teilen Europas stellt sich das Christentum inzwischen als âerkalteteâ Religion dar. Die Ăberzeugung der GlĂ€ubigen, eine Wahrheit gefunden zu haben, die das Leben prĂ€gen soll und tatsĂ€chlich bereichert, die ein jenseitiges Heil erlangen lĂ€sst und anderen Menschen mitzuteilen ist (Mission), findet man in vielen Gemeinden kaum noch. Wesentliche Inhalte des Credos und des Katechismus werden von Mehrheiten der Kirchenmitglieder selbst nicht geglaubt oder sogar ausdrĂŒcklich abgelehnt.
Die im Vergleich zu Kirchgang und Gebet relative StabilitĂ€t des bekundeten Gottesglaubens beurteilen Religionssoziologen als weder zukunftsfest noch sonderlich lebensrelevant. Sie verdanke sich neben dem Faktor der sozialen ErwĂŒnschtheit in religiösen Mehrheitskulturen auch dem Umstand, dass âĂberzeugungen anstrengungslos beibehaltenâ werden können, wĂ€hrend âPraktiken zu ihrer Aufrechterhaltung immer wieder vollzogen werden mĂŒssenâ (Pollack/Rosta: Religion in der Moderne, 2015). Dass man irgendwie an Gott glaube, ist leicht gesagt. Empirisch zeigt sich: Der Gottesdienst ist nicht nur theologisch, sondern auch kirchensoziologisch die zentrale kirchliche Veranstaltung, die die Mitglieder zu binden vermag. Die Gottesdienstteilnahme ist ein erstaunlich guter Indikator fĂŒr die individuelle ReligiositĂ€t insgesamt. Die Annahme, âdass es sich beim Kirchgang um eine bloà ÀuĂerliche Verhaltensweise handelt, die mit der individuellen ReligiositĂ€t nichts oder fast nichts zu tun hat, ist falschâ (ebd.). Dies erklĂ€rt die durchschnittlich höhere Bindungskraft der katholischen Konfession im Vergleich zur protestantischen (abgesehen von freikirchlich-charismatischen Gemeinschaften), lĂ€sst aber auch erwarten, dass angesichts des rĂŒcklĂ€ufigen Kirchenbesuchs der Glaube an Gott mit Zeitverzug ebenfalls an Bedeutung verlieren wird.
Besonders beunruhigen mĂŒssen die Kirchen âerdrutschartige AbbrĂŒcheâ (Pollack) in der jungen Generation: Ihrer Kirche verbunden zu sein, bekunden westdeutsche Unter-30-jĂ€hrige nicht einmal halb so oft wie Ăber-60-jĂ€hrige; 9 Prozent der jungen Leute beten tĂ€glich, 16 Prozent wöchentlich. Nur ein kleiner Teil der kirchlich Distanzierten oder Areligiösen findet spĂ€ter im Leben zu lebendigem Glauben und kirchlicher Praxis. Das AltersgefĂ€lle ist bei allen religiösen Indikatoren im Wesentlichen mit einem Kohorteneffekt zu erklĂ€ren. Eine Zunahme der ReligiositĂ€t im Lebenszyklus ist nicht die Regel.
Der religiöse Trend stellt sich in Westeuropa auf den ersten Blick dĂŒster dar im Vergleich zu Russland und anderen LĂ€ndern Osteuropas, in denen nach dem Kommunismus die Kirchenmitgliedschaft und die religiöse SelbsteinschĂ€tzung deutlich zunahmen. Doch auch hier bejaht meistens nur eine Minderheit die christliche Vorstellung vom persönlichen Gott (Ausnahmen: Ukraine: 55%, Polen, Albanien: 52%). Wie im Westen nehmen Formen des Glaubens an eine unpersönliche ĂŒberirdische Macht zu.
Als Zeremonienmeisterin, Moralanstalt, Sozialagentur und RĂŒckzugsort ist die Kirche auch in sĂ€kularisierten Gesellschaften wie der deutschen weiterhin erwĂŒnscht â ausdrĂŒcklich auch unter Agnostikern. Furcht vor einer âGesellschaft ohne Gottâ findet sich in Deutschland in allen Parteien. Der ehemalige deutsche AuĂenminister Joschka Fischer von den âGrĂŒnenâ schrieb in seinem Buch: âDie Linke nach dem Sozialismusâ 1992: âEine Ethik ohne religiöse Fundierung (âŠ) scheint in der Moderne einfach nicht zu funktionierenâ.
Doch sind wir ehrlich: Die Kirche wird geschĂ€tzt fĂŒr ihre erhebenden biographischen Ăbergangsrituale, als Anstandsschule fĂŒr den Nachwuchs und nicht zuletzt aus dem sozialpsychologischen Grund der Geborgenheit in der Mehrheitskultur. Zwingt man die Gruppe der Agnostiker, sich fĂŒr oder gegen den Gottesglauben zu entscheiden, optieren die westdeutschen zu 32 Prozent, die ostdeutschen nur zu 10 Prozent zugunsten des Glaubens â ein auch europaweit auffallender Befund (Slowakei: 53%, Polen: 72%). Das Christentum ist noch immer eine gesellschaftsweit akzeptierte GröĂe, die âstĂ€rker von der mehrheitlichen BestĂ€tigung als von der Herausforderung durch Wettbewerb und Konfliktâ lebt und von der sich nur eine kleine Minderheit entschieden distanziert; das vorherrschende VerhĂ€ltnis zur Kirche ist von âpragmatischem Desinteresseâ gekennzeichnet, sie ist âder Anwalt des UnverfĂŒgbaren, die Institution im Hintergrund, auf die man im Notfalle zurĂŒckgreifen möchte, an deren VollzĂŒgen man selbst aber kaum teilnimmt und die man fĂŒr die BewĂ€ltigung des Alltags selbst zumeist nicht als notwendig erachtetâ (Pollack).
Laut den Arbeiten von Andreas PĂŒttmann halten Zweidrittelmehrheiten der deutschen Bevölkerung Europa fĂŒr âsehr starkâ oder âstarkâ durch das Christentum geprĂ€gt, befĂŒrworten den schulischen Religionsunterricht und halten eine religiöse Erziehung fĂŒr wichtig fĂŒr Kinder (nur 23 Prozent widersprechen: âmacht keinen Unterschiedâ). Eine einfache Mehrheit findet es âsehrâ (18%) oder âauch wichtigâ (35%), âdass eine Partei sich an christlichen GrundsĂ€tzen orientiertâ. Das sind sogar etwas mehr Befragte als jene, die christliche Werte fĂŒr ihr eigenes Leben wichtig nennen. Ein Teil der Gesellschaft lebt anscheinend nach dem Motto: âReligion ist gut â aber fĂŒr die anderenâ (Alfred Grosser).
Die SelbstsĂ€kularisierung der ModernitĂ€tsbeflissenen fĂŒhrt aber irgendwann eine Generation spĂ€ter zur Milieuauflösung. âEine distanzierte Kirchenmitgliedschaft vererbt sich nicht. Sie stirbt ausâ (Nikolaus Schneider). Ein um den jenseitigen Glaubenskern â die Auferstehung, das Ewige Leben, das JĂŒngste Gericht, die Wiederkunft des Herrn â amputiertes Kulturchristentum hat keine wirkliche, existentielle Tröstung mehr zu bieten. Seine Sozialphilosophie mag eine Klugheitsressource bleiben, doch Menschen fĂŒr Glaube und Kirche zu âentflammenâ vermag sie nicht. Sie lĂ€sst nicht in den Gottesdienst strömen, allenfalls tröpfeln.
Biologen nennen die optische Angleichung an die Umwelt bzw. andere Arten um eines Ăberlebensvorteils willen âMimikryâ. Die Psychologie hat den Begriff ĂŒbertragen auf die Nachahmung von Mimik, Gestik und Verhaltensmustern um sozialer Beziehungsvorteile willen. Vor einer Mimikry christlichen Denkens und Lebens warnt Paulus: âGleicht euch nicht dieser Welt an!â (Röm 12, 2).
Eine klĂŒgere Reaktion auf die Abkehr vom Christentum wĂ€re: Unerschrocken in WĂŒrde zu schrumpfen, weil uns biblisch ohnehin keine durchchristianisierte âVolkskirchenâ-Gesellschaft verheiĂen ist; das geistliche und moralische Proprium bewahren und nicht jede Mode beflissen mitmachen; doch einladend, dialog- und lernbereit bleiben, auch weil von auĂen schon frĂŒher manche zunĂ€chst als âantikirchlichâ wahrgenommenen Impulse kamen, die letztlich zu einer Reinigung der Kirche, zur Justierung ihres SelbstverstĂ€ndnisses und ihrer Lehren beitrugen. Wer die âiusta autonomiaâ der Kultursachbereiche mit dem Konzil anerkennt, muss bereit sein, den (Human-) Wissenschaften nicht nur lehrend, sondern auch lernend zu begegnen.
PĂŒttmann weist darauf hin, dass Papst Benedikt XVI. fĂŒr seine 2012 in Freiburg formulierte Forderung nach einer âentweltlichten Kircheâ von liberal-katholischer Seite in Deutschland heftig kritisiert wurde. Die Versuche, seine Rede in die Schablone des âRĂŒckzugs aus der Weltâ und ins Klischee eines Sakristeichristentums zu pressen, waren einfĂ€ltig und ungerecht. Ihre Betreiber schienen ĂŒberfordert durch die Dialektik des Intellektuellen Joseph Ratzinger: Eine Kirche, die âsich in dieser Welt einrichtet, selbstgenĂŒgsam wird und sich den MaĂstĂ€ben der Welt angleichtâ, verstöĂt fĂŒr ihn gegen den Auftrag Christi, âdie Welt mit dem Wort Gottes zu durchdringenâ und zugleich ânicht von der Welt zu sein, âwie auch ich nicht von der Welt binâ (Joh 17,16)â.
Distanz und Durchdringung â das brachten die Kritiker nicht zusammen, obwohl der Papst es erklĂ€rte: âDie von ihrer materiellen und politischen Last befreite Kirche kann sich besser und auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltoffen sein. ⊠Sie öffnet sich der Welt, nicht um die Menschen fĂŒr eine Institution mit eigenen MachtansprĂŒchen zu gewinnen, sondern um sie zu sich selbst zu fĂŒhren, indem sie zu dem fĂŒhrt, von dem jeder Mensch mit Augustinus sagen kann: Er ist mir innerlicher als ich mir selbst (vgl. Conf. 3, 6, 11)â. Das klingt fast nach einer protestantisch-individualistischen Frömmigkeit.
Der deutsche Papst setzte noch eins drauf: âDie Geschichte kommt der Kirche in gewisser Weise durch die verschiedenen Epochen der SĂ€kularisierung zur Hilfe, die zu ihrer LĂ€uterung und inneren Reform wesentlich beigetragen haben. Die SĂ€kularisierungen, sei es die Enteignung von KirchengĂŒtern, sei es die Streichung von Privilegien oder Ă€hnliches, bedeuteten nĂ€mlich jedes Mal eine tiefgreifende Entweltlichung der Kirche, die sich ja dabei gleichsam ihres weltlichen Reichtums entblöĂt und wieder ganz ihre weltliche Armut annimmtâ â das liest sich wie eine Vorschau auf Papst Franziskus.
Der Papst thematisierte also die SĂ€kularisierung positiv als Chance, ermunterte zur Weltoffenheit, geiĂelte Klerikerversagen, SelbstgenĂŒgsamkeit, Reichtum und institutionelle MachtansprĂŒche der Kirche und wollte Menschen durch die Innerlichkeit ihrer Gottesbeziehung mehr âzu sich selbstâ als bloĂ in ein kirchliches NormengefĂŒge hineinfinden lassen. HĂ€tte diese Diktion liberale, reformorientierte Christen nicht frohlocken lassen und Konservative, denen es sehr um die Beachtung der Konvention und die Geltung der Institution Kirche zu gehen scheint, verstören mĂŒssen?
Meine Damen und Herren,
die zitierten Analysen von Andreas PĂŒttmann, können auch der Evangelischen Kirche bei Selbstbesinnung und Neuorientierung helfen. Und auch bei der Frage, wie wir Luther in unserer Kirche lebendig halten. Denn in der heutigen evangelischen Kirche sucht Luther seinen Platz. Gerade aber weil er lebt, sollten wir ihn nicht auf einen Denkmalsockel stellen, sondern gemeinsam mit ihm arbeiten: An einer besseren Welt, die Freiheit und Verantwortung in ihrer Verbundenheit ins Zentrum stellt. Unstrittig ist, dass Luther mit seiner Theologie und der Wechselwirkung seines Wollens mit den groĂen KrĂ€ften seiner Zeit auch ein âFaktor der Hervorbringung des modernen Bewusstseinsâ gewesen ist, wie es der SPD-nahe Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde einst formuliert hat. Doch Martin Luther fehlt heute öffentliches Gesicht und Gewicht. Die evangelische Kirche ist sich seiner nicht sicher und sucht immer wieder gerne Ersatz-Luthers: Frau KĂ€Ămann, Heinrich Böll, Willy Brandt oder den Dalai Lama. Gerne nutzt man dazu die Kirchentage. Von einem Luther-Kirchentag hat man noch nie etwas gehört.
Deshalb bedĂŒrfen Luthers Person, ihre Wirkung sowie die historischen Orte seines Handelns neuer BewusstseinsschĂ€rfung in Deutschland und weltweit. Dies sollte das Anliegen von uns evangelischen Christen sein, als Multiplikatoren fĂŒr einen Glauben, der nicht einfach nachplappert, sondern selbst erkennt durch den Einsatz von Vernunft und Herz, dass wir Gottes Kinder sind, die einen Auftrag haben.
Die Welt Luthers öffnet FreirÀume zum Gestalten. Daraus haben viele evangelische Christen gelernt. Sie waren an der friedlichen Revolution in der DDR beteiligt. Der evangelische Glaube regt zum Mitmachen, zum Verbessern an. Christen sind, dass zeigen viele demoskopische Analysen, tendenziell die deutlich Aktiveren in Staat und Gesellschaft. Engagement im Ehrenamt wÀre ohne die vielen Christen, die nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch in Parteien, Hilfsorganisationen, Vereinen oder Stiftungen mitwirken, nicht denkbar.
Die evangelische Welt ist auch deshalb machtvoll, weil sie kein Machtzentrum unterhÀlt. Die Macht sind Wort, Vernunft und Herz, noch dazu, wenn diese von Luthers Theologie aufgeladen werden.
Mit dieser Ăberzeugung, mit diesem Glauben, können wir evangelischen Christen in die Herausforderungen unserer Zeit gehen, und das nicht pietistisch-griesgrĂ€mig, sondern lutherisch optimistisch. Fröhlich soll unser Herze springen â dann packen wir an. Die Herausforderungen sind gewaltig: Ăberall auf der Welt werden Christen unterdrĂŒckt. In unserem Land sind wir Christen in der Minderheit. Es gibt, ob wir es wollen oder nicht, eine Auseinandersetzung, ich sage nicht, einen Kampf, aber eine Auseinandersetzung zwischen Christentum und Islam.
All das sollte zu einer anderen MentalitĂ€t in unserer Kirche und in ihren jeweiligen Leitungen fĂŒhren. Die Kirche der Reformation bedarf einer Reformation an Haupt und Gliedern â sonst ist sie nicht mehr zukunftsfĂ€hig und schafft sich selbst ab.
FunktionĂ€re, die sich selbstgefĂ€llig Posten im Rat der EKD und den Synoden zuschieben, Kirchenleitungen, die den Mut und Kampfeswille verloren haben, um in Sinne Luthers kraftvoll Position zu beziehen, GlĂ€ubige, die kleinglĂ€ubig geworden sind – das ist leider vielfach RealitĂ€t.
Das muss nicht sein. Hier stehen wir und können nicht anders: Warum lassen wir Protestanten es uns gefallen, dass der Reformationstag kein Feiertag ist? Dass wir mehr katholische Feiertage als evangelische haben? Warum hat die Kirche im Jahr des ReformationsjubilÀums keine Volksinitiative gestartet, um den Reformationstag als dauerhaften Feiertag bundesweit durchzusetzen? Luther hÀtte schon lÀngst im Bundestag dazu gesprochen. Warum lassen wir es zu, dass der Religionsunterricht in den Schulen immer weiter relativiert wird?
Und warum muss es in unseren Kirchen im Winter eigentlich immer so kalt sein? Es wirkt so, als wolle man die GlÀubigen zu Hause halten.
Die Welt hat sich verĂ€ndert. Der öffentlich-rechtliche privilegierte Status unserer Kirchen hat uns mĂŒde und selbstgefĂ€llig gemacht. Wir in den Kirchen mĂŒssen endlich unsere Rolle neu definieren. Wir sind inzwischen Minderheit im Lande Luthers. Aber ich kann Sie beruhigen: Wir sind zwar eine Minderheit, aber keine verschwindende, sondern eine starke Minderheit.
Aber eines ist wichtig: Aus dieser Position heraus muss Kirche anders reden und handeln â eben anders als wir es als groĂe âVolkskircheâ gewohnt waren. Dass bezieht sich auch auf die bereits erwĂ€hnten Analysen von PĂŒttmann und die Aussagen des frĂŒheren Papstes Benedikt. Strategien mĂŒssen entwickelt werden, Kindergottesdienst, Religionsunterricht fĂŒr die JĂŒngeren mĂŒssen geĂ€ndert werden. Gottesdienste anders und fĂŒr unterschiedliche Zielgruppen gestaltet werden. Die PrĂ€senz im öffentlichen Raum muss anders, unkonventioneller, kreativer betrieben werden.
Und wissen Sie was, dafĂŒr brauchen wir einen Reformator. In Hannover im Kirchenamt der EKD sucht man ihn gerade, man verlĂ€uft sich dabei allerdings in Parteizentralen und im ĂŒblichen Standardverfahren. Schade, denn der Reformator fĂŒr unsere in die Jahre gekommene Kirche stĂŒnde mit Rat und Tat bereit. Es ist Martin Luther. Und wir mĂŒssten ihm nur wieder zuhören.
Und dann gibt es noch uns Christen selbst: Denn die Aufgabe zur VerĂ€nderung ist zu groĂ, als dass sie die Kirche allein bewĂ€ltigen könnte. Es wĂ€re auch ein unlutherisches VerstĂ€ndnis von Verantwortung, diese Aufgabe nur dem offiziellen Bodenpersonal Gottes zu ĂŒberlassen. Gefragt sind wir alle. Und wir alle können wirken. Das macht die StĂ€rke unserer evangelischen Kirche aus, nĂ€mlich die Freiheit zum Handeln, auch zum unternehmerischen Handeln, und dabei verantwortlich mit unseren Talenten umzugehen, diese einzusetzen und sogar zu vermehren. Das zeigt ĂŒbrigens auch unsere heutige PreistrĂ€gerin Nicola Leibinger-KammĂŒller. Sie ist der Prototyp des protestantischen Unternehmers, der neben seiner schöpferischen Kraft zur Gestaltung und Innovation auch die soziale Verantwortung im Blick hat. Ganz besonders freue ich mich deshalb, dass Prof. Dr. Renate Köcher als Chefin des Instituts fĂŒr Demoskopie Allensbach unsere PreistrĂ€gerin wĂŒrdigen wird.
Ihnen allen aber zunĂ€chst herzlichen Dank fĂŒr die Gelegenheit, heute hier zu Ihnen sprechen zu können.
Dr. Michael J. Inacker, Vortrag vor der Internationalen Martin Luther Stiftung, 22. Oktober 2017
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 9. April 2018 um 13:07 und abgelegt unter Kirche, Theologie.