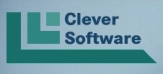Die falsch verstandene Politisierung
Montag 29. Mai 2017 von Dr. Klaus-RĂŒdiger Mai

Auf dem Evangelischen Kirchentag konnte der belehrungswillige Christ zahlreiche Foren besuchen. Die Vielzahl der Podien bildet leider nicht die Vielfalt evangelischen Glaubens ab, lĂ€sst aber in der Summe parteipolitische PrĂ€ferenzen durchscheinen. Die Politisierung der Evangelischen Kirche hat zu anhaltenden Diskussionen innerhalb der Kirche gefĂŒhrt, die nun auch den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, zu einer Stellungnahme in der FAZ bewogen haben.
Einmischung der Kirche bringt nichts Gutes
Von Anfang an widerspricht er darin der eigenen Forderung, dass prophetisches Reden den Diskurs nicht verschlieĂen, sondern öffnen soll. Denn immer wieder setzt er differierende Standpunkte in assoziative NĂ€he zum Rassismus, Nationalsozialismus oder Militarismus. Das Recht, politisch Stellung zu beziehen, wird von Martin Luther Kings Kampf gegen die Rassendiskriminierung und von Dietrich Bonhoeffers Widerstand gegen den Nationalsozialismus hergeleitet. Doch die BeweisfĂŒhrung ĂŒberzeugt weder methodisch noch historisch, denn es lieĂen sich in der Geschichte weitaus mehr Beispiele finden, wo es eben nicht zum Guten, sondern zum Schlechten fĂŒhrte, wenn sich die Kirche politisch einmischte.
Auch das schlimme Eintreten der Deutschen Christen fĂŒr den Nationalsozialismus stellte ein politisches Engagement dar. Es ist methodisch nicht zulĂ€ssig, die guten Beispiele herauszustellen, die schlechten nicht zu gewichten und die Argumentation auf die Nennung von Beispielen zu reduzieren. Ganz abgesehen davon, dass sich Geschichte immer konkret vollzieht. Genau an dieser Stelle wird die Argumentation fĂŒr eine Politisierung der Kirche hinfĂ€llig, denn der Verweis auf die Bekennende Kirche vernachlĂ€ssigt den fundamentalen Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie.
In einer Demokratie ist es problematisch, wenn sich die Kirche politisch engagiert, weil sie damit den Christen als BĂŒrger zu entmĂŒndigen droht, da sich jeder Christ in der Gesellschaft selbst als BĂŒrger in Parteien, Vereinen, im Ehrenamt politisch einbringen kann. In Diktaturen aber muss die Kirche den Menschen ihre Stimme geben, sie unterstĂŒtzen, Zeichen der Hoffnung und des Widerstandes setzen. Mehr noch, politisches Engagement in der Demokratie lĂ€uft Gefahr, sich einseitig parteipolitisch zu positionieren und spaltet daher die Kirche. Denn die Christen, die verfassungsmĂ€Ăig garantiert einer anderen Vorstellung folgen, geraten daher unweigerlich in den Dissens zur eigenen KirchenfĂŒhrung. Deutlich wurde das beispielsweise in einem Volksentscheid in Hamburg ĂŒber den RĂŒckkauf der öffentlichen Daseinsvorsorge durch die öffentliche Hand, die man privatisiert hatte. Die Landeskirche unterstĂŒtzte die Kampagne auch mit betrĂ€chtlichen finanziellen Mitteln. Die Christen, die gegen den RĂŒckkauf votierten, fĂŒhlten sich von ihrer Kirche geschurigelt und sahen Kirchensteuern entfremdet, so dass es auch zu Kirchenaustritten kam.
Besondere AutoritÀt der Propheten
Anachronistisch mutet es an, wenn die Rechtfertigung parteipolitischen Agierens mit dem prophetischen Reden der Kirche begrĂŒndet wird, denn im protestantischen VerstĂ€ndnis hat die Kirche niemals „prophetisch geredet“, Menschen allerdings schon. Die Propheten des Alten Testaments gehörten keiner „Kirche“ im heutigen Sinne an. Gerade weil sie keine KirchenfunktionĂ€re waren, konnten sie „eine leidenschaftliche moralische Empörung zum Ausdruck“ bringen, ohne „eine verlĂ€ssliche wissenschaftliche Expertise einzuholen“.
Ganz abgesehen davon, dass im Altertum keine wissenschaftlichen Expertisen existierten, weil es schlichtweg keine Wissenschaft gab. Kirchenvertreter wĂŒrden heute somit postfaktisch argumentieren, wenn sie versuchten, in die FuĂstapfen der alten Propheten zu treten. Der Ratsvorsitzende begrĂŒndet prophetisches Reden heute gesinnungsethisch und erteilt eine Befreiung von „wissenschaftlichen Expertisen“. Damit fĂ€llt er in einen Obskurantismus zurĂŒck. Folgerichtig will er prophetisches Reden an „eine besondere AutoritĂ€t“ gebunden wissen. An dieser Stelle tut Diskussion und Widerspruch not. Die Propheten erhielten ihre „besondere AutoritĂ€t“ nicht von einer Institution, sondern von Gott selbst. Nicht dem von Gott berĂŒhrten Christen stĂŒnde prophetisches Reden zu, sondern ausschlieĂlich dem von der Kirche ermĂ€chtigten FunktionĂ€r. Damit aber wird Gott im wahrsten Sinn des Wortes entmĂŒndigt und die Kirche in Laien und Priester unterteilt.
Ist man erst mal so weit, kann man Luthers Rechtfertigungslehre und das Priestertum aller Christen komplett vergessen. Keinesfalls zufĂ€llig gerĂ€t die Argumentation an diesem Punkt mit sich selbst in Widerspruch, denn die „prophetische Dimension des öffentlichen Redens der Kirche“ wird „eher an die Person als an die Institution gebunden“ gesehen, die anderseits die Vollmacht fĂŒr das prophetische Reden erst zuerkennt. Der Zirkelschluss folgt unausweichlich, denn es ist nach dieser Vorstellung letztlich der Apparat, der dem Apparat die Vollmacht erteilt. Dadurch nimmt er Gottes Position ein, der ĂŒber Gut und Böse, ĂŒber Freund und Feind entscheiden darf.
„Feindschaft“ nicht mit NĂ€chstenliebe vereinbar
Der Kulturbeauftragte der EKD möchte deshalb auch den „Feind“ theologisch definieren: „Wir brauchen einen politischen und theologischen Begriff von Feindschaft, schreibt er. „Es darf kein Appeasement geben. Man darf nicht vor dem Feind zurĂŒckweichen.“ AusdrĂŒcklich wird in diesem Beitrag klargestellt, dass „nun auch im WeiĂen Haus ein Feind der offenen Gesellschaft“ residiert. Man muss Donald Trump wahrlich nicht mögen, es spricht manches dafĂŒr, ihn als politischen Gegner zu sehen – was keine Angelegenheit der Kirchen ist. Aber dass er als Feind mit allen Mitteln zu bekĂ€mpfen ist, zu dem keine BrĂŒcke gebaut, mit dem kein Kompromiss geschlossen werden darf, zeigt, welche BlĂŒten das prophetische Reden hervorbringt. Ein Reden, das nach den Worten des Ratsvorsitzenden „den Diskurs nicht verschlieĂen, sondern ihn öffnen, vielleicht auch neueröffnen will“.
Wer aber den Feind theologisch definieren will, fĂŒr den es kein Pardon gibt, der handelt gegen das Gebot der christlichen NĂ€chstenliebe. Oder gilt NĂ€chstenliebe nur fĂŒr den lieben NĂ€chsten? FĂŒr den neuen „Feind“ des Kulturbeauftragten existieren bereits theologische Definitionen, nĂ€mlich die des antiquus hostis, des alten Feindes, schlicht: des Teufels. Es hat den Anschein, als verliere man im Inneren des Apparates den Blick nach auĂen und fĂŒhre einen geschlossen Diskurs, gefangen in der eigenen Filterblase, geleitet von den eigenen parteipolitischen Vorstellungen. Mit Hölderlin möchte man sagen: „Komm, ins Offene, Freund.“
Auf die Kernaufgaben konzentrieren
WĂ€re es nicht besser, anstatt sich ĂŒber den Staat, ĂŒber die Gesetze, ĂŒber das Recht – Stichwort Kirchenasyl -, ĂŒber die Klugheit der Menschen in den Gemeinden zu erheben, sich auf die immer wichtiger werdenden Kernaufgaben der Kirche zu konzentrieren, die da wĂ€ren: Bibelstudium, Seelsorge, Gottesdienst, Mission, Diakonie und Bildung. Den christlichen Glauben zu vertiefen und sich von einer Gesinnungsethik zu verabschieden, die im Zweifelsfall kontrĂ€r zu Luthers „Gewissen“ und kontrĂ€r zu seinem Freiheitsbegriff, der Freiheit, Gewissen und Verantwortung austariert, steht? Zumal die Kirche sich doch bis in die jĂŒngste Zeit hinein nur allzu oft geirrt hat, gerade wenn sie „prophetisch reden“ oder politisch agieren wollte, denn die EKD scheint politisches Reden mit prophetischem Reden zu verwechseln.
Dr. Klaus-RĂŒdiger Mai, geboren 1963, Schriftsteller und Historiker, verfasste historische SachbĂŒcher, Biographien und Essays, sowie historische Romane. Sein Spezialgebiet ist die europĂ€ische Geschichte.
Quelle: www.cicero.de
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
 Artikel empfehlen
Artikel empfehlen
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 29. Mai 2017 um 9:46 und abgelegt unter Gesellschaft / Politik, Kirche.